|
rezensiert von Thomas Harbach
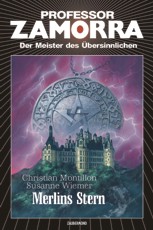 Die Professor Zamorra Hardcover sind im Zaubermond- Verlag ungewöhnlich erfolgreich. Regelmäßig erscheinen sie als eine der wenigen Serien vierteljährlich. Vor wenigen Monaten kündigte der Verlag eine zweite, parallel laufende Special Edition an, den so genannten Zamorra Director´s Cut an. Vergleichbar den silbernen PR-Bänden planten Verlag und Werner Giesa den roten Faden der einzelnen Heftromane zusammenzubinden und den Beginn der Mystery- Serie in kompakter Form neu aufzulegen. Die logischen Fehler, Brüche sollten eliminiert und spätere Ergänzungen an den richtigen Stellen eingefügt werden. Das Ziel dieser neuen Serie kann durch die Trennung zwischen Zaubermond und Werner Giesa nicht mehr realisiert werden. Da zum Zeitpunkt der Trennung der erste „Roman“ fertig gestellt worden war und ein zweiter Band in Arbeit, entschloss sich der Verlag, diese Sondereditionen im Rahmen der regelmäßig erscheinenden Hardcover zu veröffentlichen.
Die Professor Zamorra Hardcover sind im Zaubermond- Verlag ungewöhnlich erfolgreich. Regelmäßig erscheinen sie als eine der wenigen Serien vierteljährlich. Vor wenigen Monaten kündigte der Verlag eine zweite, parallel laufende Special Edition an, den so genannten Zamorra Director´s Cut an. Vergleichbar den silbernen PR-Bänden planten Verlag und Werner Giesa den roten Faden der einzelnen Heftromane zusammenzubinden und den Beginn der Mystery- Serie in kompakter Form neu aufzulegen. Die logischen Fehler, Brüche sollten eliminiert und spätere Ergänzungen an den richtigen Stellen eingefügt werden. Das Ziel dieser neuen Serie kann durch die Trennung zwischen Zaubermond und Werner Giesa nicht mehr realisiert werden. Da zum Zeitpunkt der Trennung der erste „Roman“ fertig gestellt worden war und ein zweiter Band in Arbeit, entschloss sich der Verlag, diese Sondereditionen im Rahmen der regelmäßig erscheinenden Hardcover zu veröffentlichen.
Um den ursprünglichen Roman von Susanne Wiemer hat Christian Montillon weitere Handlungsstränge gewoben, um das heute fast dreißig Jahre alte Werk nicht mehr so antiquiert und altbacken erscheinen zu lassen. Dabei legt der Dirigent Montillon sehr viel Wert darauf, dass sich das Epos wie aus einem Guss liest.
Der Kern dieses Buches, aber nicht der Hauptbestandteil ist der erste Roman „Das Schloss der Dämonen“ von Susanne Wiemer, die unter diversen Pseudonymen Gespenster Krimis, Horror- Romane, Thriller und ab 1979 im Alleingang die umfangreiche Science Fiction Serie „Söhne der Erde“ geschrieben hat. Unter dem Sammelpseudonym Robert Lammont, das sich später Werner K. Giesa zu Eigen machte, erschien dieser Roman am 02.07. 1974.
Dr. Ramando foltert in den Verließen von Schloss Louis de Montagne den Hausherrn und einen Verwandten Professor Zamorras. . Er versucht aus ihm das Versteck eines geheimnisvollen Amuletts zu erpressen. Dieser widersteht der Folter standhaft und versucht seinen Widersacher in die Falle zu locken. Doch das Böse gewinnt die naturgemäß auf dem ersten Handlungsabschnitt vorläufig die Oberhand und der letzte Ahnherr stirbt.
Damit beginnen auch die Verstrickungen Zamorras in den Kampf gegen das Böse. Von Beginn an begleitet ihn die skeptische Nicole Duvall. Sicherlich einer der ständigen Kritikpunkte an der Serie, dass seine Sekretärin trotz der vielen direkten Begegnungen mit Dämonen, Teufeln und Gespenstern weiterhin skeptisch bleibt und sich erst sehr zögerlich davon überzeugen lässt, dass ihre Realität nicht die einzige Ebene unserer Welten ist.
Die Passage, in denen Nicole Duvall als Sekretärin beim Professor anfängt, hat Christian Montillon ja von Werner Giesas „Zeit der Teufel“ gedanklich einbauen können, im
ursprünglichen Heftromanauftakt arbeitete die schöne Frau schon etwas länger in den Diensten des attraktiven und gar nicht so weltfremden Mannes.
„Er war ein großer, schlanker Mann, dunkelhaarig, mit hellwachen grauen Augen in einem schmalen, markanten Gesicht.“ So lautete die charakteristische Beschreibung im ersten Roman. Aber auch die Sekretärin bekommt ihre Hommage: „Er hatte sich inzwischen an Nicoles Eigenschaften gewöhnt. Nur an den Blick ihrer verteufelt hübschen Augen würde er sich wohl nie gewöhnen. Dunkelbraune Augen, hellgesprenkelt. Winzige Tupfen, die wie Goldfunken tanzen konnten. Und die bisweilen auch verschwanden, wenn sich die Irisringe verdunkelten und zu schwarzen Seen wurden. Nicole war ein echter Glücksfall. Schön,
intelligent, sprühend vor Lebendigkeit und Charme – und im Bedarfsfall so zuverlässig wie ein Felsen in der Brandung.“
Vom Tod Professor Zamorras Verwandten unterrichtet, reisen die Beiden nach Frankreich. Hier kommt es zu ersten Begegnung mit seinem zukünftigen Zuhause. „Er, Zamorra, würde zum ersten Mal seit langen Jahren auf das Schloss seiner Vorfahren zurückkehren müssen. Und er ahnte bereits, dass dieser Besuch mehr werden würde als irgendein bedeutungsloses Zwischenspiel… Loire- Tal… ein altes Schloss, alte Gemäuer, geheimnisvolle Verließe und eine Menge Legenden und Sagen. Ich glaube, Sie werden einige ihrer Ansichten ändern, wenn sie Chataeau Montagne erst einmal kennengelernt haben, Nicole.“
Dann beginnt sich Zamorra mit der dunklen Geschichte des Schlosses auseinanderzusetzen. Über viele Generationen haben sich die de Montagne mit der dunklen Seite verschiedene Kämpfe geliefert und der Macht des Bösen getrotzt. Zur Seite stand ihnen ein geheimnisvolles Amulett, das
…“der Kalif aber änderte seinen Sinn und machte ihm ein Amulett zum Geschenk, auf das er herrsche über die Mächte der Finsternis, über Dämonen und Geister…“.
Natürlich gelingt es Zamorra, die Bösewichte in diesem wie auch in vielen anderen Romanen zu bezwingen. Christian Montillon hat diese Geschichte genommen und entsprechend mit einem Vor-, einem Mittel und einem Schlussteil versehen. Dabei musste er nicht nur auf die Kontinuität der Heftromane achten, inzwischen gibt es ja mit „Zeit der Teufel“ einen weiteren Roman, der vor dem ersten Werk Wiemers spielt und in dem sich Zamorra und seine bildhübsche Sekretärin kennen lernen. Dabei ist der Kern dieses sehr gut gestalteten Hardcovers aus heutiger Sicht wie für das vorletzte Jahrhundert geschrieben worden. Ein typischer Gothic Horror Roman mit seiner übertriebenen Sprache – hier ins gängige Deutsch und den Rahmen übertragen - , den geheimnisvollen Kammern und überdimensionalen, aber so entsetzlich steifen Gegnern sowie der mit einem schockierenden Auftakt beginnenden, dann sehr geradlinigen Handlung. Trocken, humorlos und stellenweise doch reichlich brutal setzt die Autorin das Geschehen in Szene. Die Geschichte trägt noch deutlich die Züge klassischer Geistergeschichten in der Tradition Edgar Allan Poes, der Übergang zum Mystery sollte ja erst gute 110 Hefte später unter der Ägide Werner K. Giesas erfolgen. Trotzdem finden sich insbesondere mit Merlins Stern die ersten Hilfsmittel, auf die das Team immer wieder zurückgreifen konnte. Bei der Charakterisierung der Figuren konnte Wiemer schon mit den klassischen Klischees spielen, so überzeichnet sich Nicoles Perückentick als Markenzeichen einer modernen Frau.
Trotzdem lesen sich einzelne Passagen wie aus einem romantischen Schmachtfetzen, mit breitem Pinsel gemalt und unwiderstehlich kitschig. Das man mit dieser elitären Mischung aus Gewalt und jugendfreiem Sex Erfolg haben konnte, unterstreicht kurze Zeit später der ersten Roman Giesas um den Geisterreporter Ted Ewigk. In der empfehlenswerten Neuauflage hat der Autor den ersten Roman nicht überarbeitet und so fallen die stilistischen Ungereimtheiten, die Lockerheit der siebziger Jahre und die geballte Kraft eines noch ungeschliffenen Unterhaltungsautoren selbst unter nostalgischen Gesichtspunkt unangenehm auf.
Allerdings greift sie dann gegen Ende des Romans in die bewährte Trickkiste. Über weite Strecken unterscheidet sich dieser erste Zamorra nicht von den hunderten von simplen Horror-Romanen, die es überall zu kaufen gegeben hat. Im Gegensatz allerdings zu den populären DÄMONENKILLER- Reihe, die von vorneherein mit ihrer historischen Anlehnung und den genauen Recherchen eine außergewöhnliche Basis präsentierten, überzeugt die Handlung nur in bescheidendem Umfang. Alles wirkt ungewöhnlich hölzern, steif und umständlich zufällig angelegt. Nichts deutet in diesem Buch auf die stetige und interessante Entwicklung hin, die in den folgenden dreißig Jahren und mehr als achthundert Heften folgen sollte.
Da der ursprüngliche Roman in dieser neuen Fassung nur ein gutes Drittel der Handlung einnimmt, hat sich Christian Montillon die Zeit und den Raum genommen, in der Vorgeschichte dem Leser sowohl Zamorra als auch seinen Onkel näher zu bringen. Dabei folgt er Werner Giesas Roman „Zeit der Teufel“ und bemüht sich eher, ein leichtes, lockeres und allgemeinverständliches Bild der Charaktere zu zeichnen als krampfhaft jeden Nuance in das bestehende Universum zu integrieren. Da er weiß, dass die meisten Leser Zamorra Anhänger sind und der Band in dieser Gestaltung kaum neue Leser anziehen wird, erweitert der Autor das bestehende Bild in einer humorvollen und damit in scharfem Kontrast zum humorlosen Wiemer- Werk. Montillon bemüht sich, die richtige Mischung aus angenehmen Grusel und leichter Unterhaltung zu finden. Das er der klassischen Figur Asmodi
Tiefe gibt, ist für die Kontinuität der folgenden Romane sehr wichtig und beschert den Fans ein angenehmes Gefühl des Wiedererkennens.
Im Zwischenraum des Wiemer Roman bemüht er sich, sowohl dem Dr. Ramondo als auch Acharat nicht nur einen Hintergrund, sondern eine nachvollziehbare Mission zu geben. Dabei entwickelt er eine gewisse Dreidimensionalität der Figuren. Das er keine Widersprüche aufbaut und dem zugrunde liegenden Roman Respekt zollt, ist ein weiteres Attribut der Mühe, die sich Montillon gegeben hat. Augenscheinlich ist diese Bastelei für ihn nicht eine schriftstellerische Pflichtaufgabe gewesen, sondern Freude an der Arbeit.
Wie schwierig es dann allerdings ist, den Roman zu einem befriedigenden Ende zu führen, zeigen die Wiederholungen der Metamorphose Arachats und das an „Trouble with Harry“ erinnernde Spiel mit der Leiche, die mal tot und dann wieder ein bisschen lebendig ist. Der Epilog ist eine Aufzählung einiger der ersten hundert Titel und eine gebührende Würdigung der Grundlage, auf der sich das Professor Zamorra Universum stützt. Hätten Fans diese heute oft verschmähten Titel nicht gekauft, hätte die Giesa Ära nicht eingeleitet werden können.
Schon in seinen bisherigen Arbeiten hat Christian Montillon unterstrichen, welch ein guter Teamautor er ist. Sein Stil ist flüssig, an den richtigen Stellen farbenprächtig, aber niemals bombastisch oder aufdringlich. Dadurch ist er für eine solche Puzzlearbeit prädestiniert. Nichts schadet einem Roman mehr, als wenn die einzelnen Stücke wie Versatz wirken. Das ist hier nicht der Fall. Auch wenn sich im letzten Drittel der Handlung einige Schwächen einstellen, überzeugen in erster Linie der gelungene Auftakt und der fließende Übergang in den alten Roman. Für Anhänger der Serie kommt damit ein weiteres Highlight hinzu. Die allererste Geschichte nach dem neuen Einführungsband. Mehr und mehr entwickeln sich die handlichen und optisch gut gestalteten Bücher zu Mischungen aus spannenden Abenteuern und Hintergrundberichten – siehe „Zeit der Teufel“ oder „7“. Nach einigen schwächeren Romanen, bei denen die Absicht der Autoren deutlich größer war als ihre literarischen Fähigkeiten ist „Merlins Stern“ trotz des zu simplen und nicht unbedingt passenden Titels eine empfehlenswerte Arbeit und ein idealer Einstieg für Neugierige.
Christian Montillon und Susanne Wiemer: "Merlins Stern"
Roman, Hardcover, 288 Seiten
Zaubermond Verlag 2005
Leserrezensionen
|
29.08.06, 00:15 Uhr
|
Florian Hilleberg
Benutzer/in
registriert seit:
Aug 2006
|
Dies war also der erste Band der neuen Serie, die ja nun nicht mehr erscheinen wird. Einerseits finde ich das nicht so schlimm, andererseits wäre das aber eine gute Gelegenheit gewesen Nebenfiguren einen größeren Hintergrund zu geben, wie eben in diesem Falle, Dr. Ramondo und Acharat. Den Titel „Merlins Stern“ finde ich allerdings nicht sonderlich passend, da das Amulett ja nur gefunden und zum ersten Mal eingesetzt wird, ansonsten hat es eine eher untergeordnete Rolle. Doch der Roman an sich kann sich sehen lassen. Christian Montillon hat es exzellent verstanden dem ersten PZ-Roman ein neues Gewand zu verschaffen und den Text von Susanne Wiemer einzugliedern. Dabei musste dieser an der einen Stelle etwas gekürzt und an der anderen ein wenig verlängert werden. So bleibt der Tod von Onkel Louis nicht mehr ausschließlich der Fantasie überlassen, sondern wurde um eine deftige Splattervariante bereichert. Die Vorgeschichte erzählt etwas ausführlicher über Zamorra und seinen Onkel und auch ein erster Blick in die Gefilde der Hölle wird getan, wobei schon die erste Bekanntschaft mit Asmodis geschlossen wird und mit Karinjo ein interessanter Bösewicht die Bühne betritt. In der Zwischengeschichte erhalten dann Dr. Ramondo und vor allem Acharat einen Hintergrund und zumindest letzterer wird zu einem denkenden Wesen mit Wünschen und Hoffungen. Die Grundgeschichte wird dabei nicht aus dem Zusammenhang gerissen, wofür dem Autor ein angemessener Respekt gezollt werden sollte. Die Abschlussgeschichte hätte dahingegen nicht ganz so ausgewalzt werden müssen. Es dreht sich eigentlich nur noch um die Bekämpfung Karinjos und meiner Meinung nach war Acharats weitere Metamorphose überflüssig. Ebenso wie das Hin und Her mit der Leiche, die einmal lebte, dann wieder tot war, wieder lebte und endgültig starb. Da hätte man ruhig ein paar Seiten einsparen können. Ebenso gewöhnungsbedürftig ist der Epilog, der zwar ganz interessant zu lesen ist, aber im Prinzip nur eine Auflistung der ersten hundert Romane darstellt. Wenigstens wurden die Fälle nicht totgeschwiegen und unter den Teppich gekehrt.
Außerdem scheint der Autor eine Vorliebe für Macabros zu besitzen, insbesondere für die Hörspiele. Nach dem ein Zitat sogar als Einführung in ein Kapitel herhalten musste, erinnerte mich die Verballhornung von Wissenschaftler in „Vermutungsschaftler“ frappierend an das Macabros-Hörspiel Nr. 6 „Blutregen“.
|
|
|
|
|