|
rezensiert von Thomas Harbach
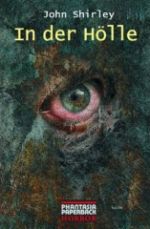 Schon in seiner futuristischen Rocktrilogie „Eclipse“ hat John Shirley seine pessimistische Weltsicht und sein fehlendes Vertrauen in seine Mitmenschen in einer nihilistischen Ballade ausgedrückt. Mit „ A View from Hell“ überträgt er diese Vision in das Horrorgenre. Für ihn ist die Hölle kein mystischer Platz, sie ist elementarer Bestandteil seiner gebrochenen Charaktere. Die Hölle ist das, was wir aus uns machen und sie ist überall dort, wo Menschen sind. John Shirley ist sicherlich einer der Horror Autoren, deren Werk am schwersten einzuordnen ist. Unter dem Pseudonym John Cutter hat er die „The Spezialist“ Romane geschrieben, die später mit Sharon Stone und Silvester Stallone verfilmt worden sind. Er hat für die Gruppe „Black Oyster Cult“ deren letzten beiden Alben getextet. Im Jahre 1970 hat er mit seiner Frau einige Zeit auf der Straße gelebt. Er stammt aus einem sehr gut bürgerliche Hause, seine Mutter ist Sonderschullehrerin gewesen, sein Vater Manager in einem Autoteilezulieferbetrieb. Sein literarisches Werk ist insbesondere im Bereich Horror zynisch, dunkel, erinnert an Andrew Vacchs Krimis. Sein Stil ist pointiert und versprüht eine ätzende Säure, die den dunklen Kern der Menschen rücksichtslos entblößt.
Schon in seiner futuristischen Rocktrilogie „Eclipse“ hat John Shirley seine pessimistische Weltsicht und sein fehlendes Vertrauen in seine Mitmenschen in einer nihilistischen Ballade ausgedrückt. Mit „ A View from Hell“ überträgt er diese Vision in das Horrorgenre. Für ihn ist die Hölle kein mystischer Platz, sie ist elementarer Bestandteil seiner gebrochenen Charaktere. Die Hölle ist das, was wir aus uns machen und sie ist überall dort, wo Menschen sind. John Shirley ist sicherlich einer der Horror Autoren, deren Werk am schwersten einzuordnen ist. Unter dem Pseudonym John Cutter hat er die „The Spezialist“ Romane geschrieben, die später mit Sharon Stone und Silvester Stallone verfilmt worden sind. Er hat für die Gruppe „Black Oyster Cult“ deren letzten beiden Alben getextet. Im Jahre 1970 hat er mit seiner Frau einige Zeit auf der Straße gelebt. Er stammt aus einem sehr gut bürgerliche Hause, seine Mutter ist Sonderschullehrerin gewesen, sein Vater Manager in einem Autoteilezulieferbetrieb. Sein literarisches Werk ist insbesondere im Bereich Horror zynisch, dunkel, erinnert an Andrew Vacchs Krimis. Sein Stil ist pointiert und versprüht eine ätzende Säure, die den dunklen Kern der Menschen rücksichtslos entblößt.
Im Jahre 2001 veröffentlichte er den Kurzroman „A View from Hell“. Alleine der Titel ist ein Spiel mit den Erwartungen der Leser. Denn obwohl die Protagonisten anscheinend Opfer von zwei kleinen Unterteufeln mit Buchstaben als Namen geworden sind, offenbart insbesondere die fragmentarische Struktur zu Beginn des Buches und zwischen den einzelnen Kapiteln, das die hier angesprochene Hölle unsere Erde, unsere Gegenwart ist. In den eigentlichen Episoden übertreibt John Shirley zumindest in seinem handlungstechnischen Konstrukt, der brutal realistische Beginn mit der Kinderprostitution – eine Extrapolation von Charles Dickens „Oliver Twist“ – geht aber dem Leser unter die Haut. Der eigentliche Episodenroman hat noch nicht begonnen, schon schockiert John Shirley seine Leser und stimmt sie nachhaltig auf das Kommende ein. Trotz einer zuteil splattrigen Mischung aus Brutalität und Sex kann er seinen großartigen Auftakt nicht übertreffen und die Gedanken des Lesers bleiben noch lange bei den Kopfbildern zurück, während der eigentliche Roman begonnen hat.
Allerdings macht es sich John Shirley zumindest in Hinblick auf den Hintergrund seiner Geschichte einfacher. Im Gegensatz zu gängigen Plätzen wie New York – siehe auch Larry Cohens herausragenden Film „God told me to“ – siedelt er seine in der „Short Cuts“ Tradition erzählte Fuge im sonnigen Kalifornien an. Als erstes lernt der Leser den eigentlichen Erzähler und teilweise Verursacher dieser Schicksalsgeschichten kennen: ein wahrscheinlich außerirdisches Energiewesen, für den die Menschen bislang ein beliebtes Beobachtungsobjekt und schließlich zu einem Experimentierfeld geworden sind. Dieses Wesen verfügt über eine scheinbar grenzenlose Macht, die es im Verlaufe des Romans immer mehr aktiv einsetzt. Sein Ziel ist die Schaffung eines Terrariums, in dem sich am Ende des Plots seine Versuchsratten zu einer abschließenden „Orgie“ sammeln. Was für den Fremden ein intellektuelles Element, aber auch ein Stimulus ist, ist für die betroffenen Protagonisten manchmal selbst verschuldet das Ende ihrer bisherigen bürgerlichen Scheinexistenz. Mit viel boshaftem Zynismus verbindet John Shirley ihre Schicksale mit dem Schein des amerikanischen Traums. Vom Aufbau her orientiert sich der Autor an Erik Frank Russels allerdings auf einer positiven Note außerirdischen Vitons und nicht selten erinnert die Struktur auch an eine groteske Parodie auf die zahllosen „Star Trek“ Folgen der sechziger Jahren, in denen sich Kirk, Spock und Co. endlosen Tests von körperlichen Energiewesen stellen musste. Im Gegensatz zu den Episoden, in denen der kalte Intellekt und das überlegene menschlichen Wesen jeden Außerirdischen am Ende besiegen konnten, sind Shirleys Protagonisten erbärmliche Kreaturen. Da in dieser Umgebung dank der überirdischen Kräfte Mord oder Selbstmord negiert werden können, fallen schnell – und das eher unbewusst, da die Täter nicht wissen, dass sie Versuchsobjekte sind – die moralischen Grenzen. Aber die Opfer entsprechen auch nicht den klassischen Durchschnittsbürgern, John Shirley sucht schon die Konfrontation mit den Mitgliedern unserer Gesellschaft, die schon immer die Regeln gebrochen oder zumindest gebogen haben.
Das beginnt mit Younger, dem jungen TV- Produzenten, der mit einer nach Soaps strukturierten Fernsehserie über den Zweiten Weltkrieg auf den Durchbruch hofft. Auf der Fahrt zu der früher angesetzten entscheidenden Sitzung fährt er eine Fahrradfahrerin an. Allerdings kümmert sich Younger um sie, findet sie später mit 7000,-- Dollar ab. Au der Sitzung selbst wird ihm ein unmoralisches Angebot gemacht. Nur wenn seine Freundin mit dem Geldgeber schläft, kommt die Produktion zustande.
Die Hausfrau Lu Ann pumpt sich neben der Antibabypille mit Aufputschmitteln voll, die unbekannte Nebenwirkungen haben. Sie bringt schließlich ihren Mann um. Diese Handlungsebene erinnert fatal an Liebermanns „Blue Sunshine“, auch wenn den Protagonisten die Haare bleiben.
Die Pharmaindustrie hat aufgrund der potentiell gefährlichen Wirkung ihres Medikaments Angst vor den Anwälten und der Öffentlichkeit. Der einzige Weg erscheint einem Mitglied des Führerstabs, seine Frau mit den Mitteln voll zu pumpen, sie Amok laufen zu lassen und aufgrund eines gefälschten Blutbildes zu beweisen, dass nur Stress als Täter in Frage kommt. Dieses Segment wirkt auf den ersten Blick wie eine bitterböse Kriminalkurzgeschichte, die John Shirley nachträglich wieder in den Roman integriert hat.
Keiner der Protagonisten ist dem Leser wirklich sympathisch. ER folgt die zum Teil drastisch geschilderten Schicksal aus einer unüberbrückbaren Distanz. Es wäre vielleicht für den Roman besser gewesen, einfache gewöhnliche Menschen als Versuchsobjekte zu nehmen. Die Gewissenlosigkeit Hs wäre besser zum Ausrdruck gekommen. So wirken einige der Szenen wie Klischees aus den zum Teil extrem überdrehten Hollywoodsatiren, die im Grunde nicht das Leben Hollywoods widerspiegeln, sondern ihre eigene Irrealität erschaffen haben. Und in dieser Kunstwelt findet auch das Experiment statt. Erst gegen Ende des allerdings sehr kompakt geschriebenen Romans erheben sich wirklich überzeugende Charaktere aus dieser kontinuierlichen Ansammlung brutalen Szenen und beginnen einen Hauch von Menschlichkeit zu zeigen. Im gleichen Atemzug beendet John Shirley die übergeordnete Handlungsebene um den Erzähler H auf einer ironischen, aber ein wenig platt wirkenden Pointe. Zumindest einer ist mit Hs Arbeit zufrieden gewesen. In Shirleys dunkler Welt gibt es aber auch kein Gegengewicht und das macht die Lektüre zum Teil zu einer beabsichtigte, aber nicht immer wirklich überzeugenden Tour der Leiden. Gegen Ende des Romans versucht der Autor überzeugend die einzelnen Handlungsebenen seiner literarischen Fuge in einer überdrehten Orgie zusammenzufassen, die Toten sind wiedererwacht und der aufgezeigte Kreislauf könnte von neuen beginnen. Hier wäre es vielleicht auch interessanter gewesen, H ein neues, noch bitterböseres Experiment starten zu lassen und vor allem seine Skrupellosigkeit zu unterstreichen. John Shirley verzichtet auf eine handlungstechnische Erweiterung und schließt den Blick in die Höhle auf einer zumindest hoffnungsvollen Note ab. Dazwischen stehen zum Teil auch in der Übersetzung von Joachim Körber erhalten gebliebene groteske Bilder einer Konsumgesellschaft, die ihre inneren Werte nicht erst durch das Experiment Hs verloren hat. John Shirley will keine Lösungsansätze aufzeigen, nicht polarisieren, sondern verbal schockieren und den Leser aus seinem Wohlstandsschlaf aufwecken. Dazu fehlen ihm insbesondere bei einigen der hier zusammengefassten Episoden die über das banale und in den letzten sechs Jahren seit dem Entstehen der Novelle oft praktizierte Schreckensszenario hinausgehenden Ideen. Ein sehr guter Anfang, ein überdrehtes Ende und dazwischen ein wenig menschliches Leid auf einer sozialen Ebene, die keinen Bezug zu den hier beschriebenen Charakteren haben und aufbauen können. Was den eigentlichen Schrecken, das Grauen angeht, extrapoliert John Shirley nicht Clive Barkers sehr gute Geschichten in seinen „Büchern des Bluts“, sondern verlagert deren Tenor auf eine metaphysische Ebene und verzichtet auf den finalen Abschluss. Ein gutes Buch, eine interessant zu lesenden Novelle, aber selbst im Zusammenhang mit John Shirleys Gesamtwerk nur eine überdurchschnittliche, aber keine herausragende Höllenvision.
-
John Shirley: "In der Hölle"
Roman, Softcover, 152 Seiten
Edition Phantasia 2007
ISBN 3-9378-9722-4

Leserrezensionen
:: Im Moment sind noch keine Leserrezensionen zu diesem Buch vorhanden ::
:: Vielleicht möchtest Du ja der Erste sein, der hierzu eine Leserezension verfasst? ::
|