|
rezensiert von Thomas Harbach
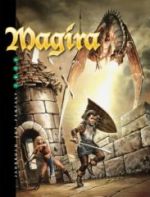 Gleich zu Beginn immer wieder der bewundernswerte Hermann Urbanek Rückblick auf die Zeit zwischen den Jahrbüchern. Nach den Zahlen – weniger Einzelveröffentlichungen – kommt der individuelle Streifzug durch die Verlage. Da er die einzelnen Höhepunkte im Block ohne weitere kritische Kommentare präsentiert, wirkt es gedrängt. Fragwürdig ist allerdings, warum der gute Hermann auf „Alien Contact“ hinweist, dass pünktlich erscheinende Magazin „phantastisch“ aber vergisst. In beiden hält sich der Anteil zwischen Fantasy und Science Fiction, Utopie und Phantastik die Waage. Es stellt sich die Frage, ob eine Rückkehr zum Listenverfahren – und dann alle Titel – nicht sinnvoller wäre. Der Leser könnte sich in Kombination mit den folgenden Besprechungen die technischen Daten der interessanten Titel gleich heraussuchen, Sammler könnten sehen, ob es nicht doch noch eine schließenswerte Lücke gibt und eine Integration der Originaltitel als Abschluss würde einen guten Brückenschlag zu Werner Arends Bücherkiste bilden. Dieser hat zumindest im vorliegenden Artikel deutliche Schwierigkeiten, gute und empfehlenswerte englische Originaltitel herauszusuchen. Das liegt zum einen an seinen nicht immer glücklichen Spontankäufen, zum anderen aber auch an einer Tendenz, die wir auch in Deutschland feststellen. Viele interessante und empfehlenswerte Titel erscheinen mehr und mehr in den Randbereichen des phantastischen Genres. Hier hilft oft nur die unermüdliche Arbeit des „Locus“- Teams, um wirklich gute und auch für ein deutsches Publikum sehr empfehlenswerte Bücher vorzustellen. Werner Arend weicht in seiner Kolumne schon auf ältere Titel – Tanith Lee oder George R.R. Martin – aus. Selbst die Besprechung seiner Topempfehlung „The Darkness that comes before“ – inzwischen den Klett Cotta auf Deutsch erschienen – liest sich zwar gut, aber er arbeitet nicht deutlich und vor allem überzeugend genug heraus, warum ausgerechnet dieser Roman das Genre erweitert oder zu den zehn besten Büchern gehören soll. Die Idee, in Deutsch angefangene Zyklen mit den entsprechenden noch nicht übersetzen Originalen zu ergänzen und Vergleiche zwischen der oft schlechten, da billigen Übersetzung und dem Ursprung anzustellen, ist sehr gut und kompensiert die Schwächen in den anderen Besprechungen. Manfred Roths Nachruf auf Robert Sheckley in zweierlei Hinsicht seine Schwäche. Zum einen werden in dieser Art von Jahrbuch die anderen verstorbenen Autoren des phantastischen Genres nicht erwähnt, zum anderen hat ein warmherziger, humorvoller Autor wie Sheckley diese Art von letzten Worten von einem
Gleich zu Beginn immer wieder der bewundernswerte Hermann Urbanek Rückblick auf die Zeit zwischen den Jahrbüchern. Nach den Zahlen – weniger Einzelveröffentlichungen – kommt der individuelle Streifzug durch die Verlage. Da er die einzelnen Höhepunkte im Block ohne weitere kritische Kommentare präsentiert, wirkt es gedrängt. Fragwürdig ist allerdings, warum der gute Hermann auf „Alien Contact“ hinweist, dass pünktlich erscheinende Magazin „phantastisch“ aber vergisst. In beiden hält sich der Anteil zwischen Fantasy und Science Fiction, Utopie und Phantastik die Waage. Es stellt sich die Frage, ob eine Rückkehr zum Listenverfahren – und dann alle Titel – nicht sinnvoller wäre. Der Leser könnte sich in Kombination mit den folgenden Besprechungen die technischen Daten der interessanten Titel gleich heraussuchen, Sammler könnten sehen, ob es nicht doch noch eine schließenswerte Lücke gibt und eine Integration der Originaltitel als Abschluss würde einen guten Brückenschlag zu Werner Arends Bücherkiste bilden. Dieser hat zumindest im vorliegenden Artikel deutliche Schwierigkeiten, gute und empfehlenswerte englische Originaltitel herauszusuchen. Das liegt zum einen an seinen nicht immer glücklichen Spontankäufen, zum anderen aber auch an einer Tendenz, die wir auch in Deutschland feststellen. Viele interessante und empfehlenswerte Titel erscheinen mehr und mehr in den Randbereichen des phantastischen Genres. Hier hilft oft nur die unermüdliche Arbeit des „Locus“- Teams, um wirklich gute und auch für ein deutsches Publikum sehr empfehlenswerte Bücher vorzustellen. Werner Arend weicht in seiner Kolumne schon auf ältere Titel – Tanith Lee oder George R.R. Martin – aus. Selbst die Besprechung seiner Topempfehlung „The Darkness that comes before“ – inzwischen den Klett Cotta auf Deutsch erschienen – liest sich zwar gut, aber er arbeitet nicht deutlich und vor allem überzeugend genug heraus, warum ausgerechnet dieser Roman das Genre erweitert oder zu den zehn besten Büchern gehören soll. Die Idee, in Deutsch angefangene Zyklen mit den entsprechenden noch nicht übersetzen Originalen zu ergänzen und Vergleiche zwischen der oft schlechten, da billigen Übersetzung und dem Ursprung anzustellen, ist sehr gut und kompensiert die Schwächen in den anderen Besprechungen. Manfred Roths Nachruf auf Robert Sheckley in zweierlei Hinsicht seine Schwäche. Zum einen werden in dieser Art von Jahrbuch die anderen verstorbenen Autoren des phantastischen Genres nicht erwähnt, zum anderen hat ein warmherziger, humorvoller Autor wie Sheckley diese Art von letzten Worten von einem
zu sachlichen, zu distanzierten und vor allem wenig mit seinem Werk vertrauten Autoren nicht verdient. Leider wird auch Kenneth Bulmer weder von Klaus Erichsen noch Bernd Kunz ein wirklich Denkmal gesetzt. Letzteres fasst den Inhalt der umfangreichen Scorpio- Serie zusammen und scheitert dann an seinem eigenen Fazit. Auf die Frage, ob man diese sehr umfangreiche Serie wirklich gelesen haben sollte, antwortet er mit einer ausweichenden Floskel. Klaus Erichsen dagegen trägt eine Reihe von interessanten Fakten über den Autoren zusammen. Sein Beitrag scheitert an seiner Konzeptlosigkeit. Entweder er arbeitet mit Absolutismen, die er nicht weiter begründet oder er versucht bekannte Konzepte immer detaillierter zu erläutern und findet schließlich den roten Faden nicht mehr zurück zu seinem Ausgangspunkt. Auch stilistisch wirkt alles sehr bemüht, fast verkrampft und nicht fließend. Der Artikel liest sich ungewöhnlich schwerfällig und am Ende kann man über die Überschrift „Fast ein Klassiker…“ nur schmunzeln. Es ist schade, dass Begriffe wie Klassiker oder Meisterwerk inzwischen immer öfter zweckentfremdet werden und damit vor allem den damit titulierten Personen nicht gerecht werden. Ein Autor wie Bulmer gehört zusammen mit Kenneth Robeson in die Pulpschublade und zumindest Robeson fühlte sich als Schriftsteller anregender und leichter Unterhaltungsliteratur sehr wohl.
Zwei weitere Artikel widmen sich der Verfilmung der NARNIA- Bücher und der kommerziellen Ausnutzung des Themas. Uwe Kraus bemüht sich, die Verfilmung fair und objektiv zu besprechen. Hermann Ritter rügt die Lewis- Flut im ersten Teil seines Artikels – ohne den Verkauf von Namensrechten und Lizenzen keine so teuren Verfilmungen, sprich, das eine, was man will, das andere was man kriegt – gibt zu, dass er sich die Verfilmung nicht angesehen hat und ansehen will und bespricht dann eine Reihe von Büchern zu diesem Thema. Herrmann Ritter versucht sich wieder zu Beginn seines Artikels als nicht unbedingt leidensfähiger Zyniker zu verkaufen. Ist ja auch sehr einfach und inzwischen viel zu oft Marotte. Dann bespricht er insgesamt acht Bücher. Das zweitschlechteste Urteil ist „insgesamt eine Halbheit mit netten Höhepunkten“. Dann finden sich sehr viele „schöne Bücher“ und ein Scheitern auf einer ganzen Linie. Eine für die heutige phantastische Literatur ausgezeichnete Quote. Wenn dann auch noch berücksichtig wird, dass 50 % dieser Bücher nichts mit der Verfilmung zu tun haben – sie sind deutlich früher erschienen und wurden höchstens in Deutschland im Zuge der Popularität aufgelegt, auch nicht unbedingt schlecht, wenn es sich laut Herrmann Ritter um interessante, gute oder schöne Bücher handelt -, ist seine Einführung eher populistisch. Er stellt einige sehr interessante Bücher vor, die inzwischen nach dem Abklingen der ersten NARNIA Welle wahrscheinlich auch günstiger zu erhalten sind.
Ein weiterer Themenschwerpunkt ist Musik und Fantasy. Drei Autoren – Dietmar Dath, Pia Gramlich und Volker Kuhnle – beschäftigen sich mit verschiedenen Aspekten. Während Volker Kuhnle seinen Artikel aus dem letzten Jahrbuch über Tolkien und Musik fortsetzt, analysiert Dath zu kurz und zu oberflächlich die Verbindung der Musik zur phantastischen Literatur – das Spektrum reicht von William Blake bis David Sims Cerebus. Hier hätte man als interessierter Leser mehr Details erwarten können. Oft beschränkt sich Dath auf Querverweise und zählt einige wenige Beispiele auf. Pia Gramlich gleich im Vorwort ihre Vorliebe für Rock und Fantasy erläutert, dann einige Definition festzurrt und eine Handvoll Alben vorstellt. Das alles recht fließend und informativ.
Im Mittelpunkt eines jeden Jahrbuches stehen allerdings die Vorstellungen von interessanten Autoren und sehr viele Buchkritiken. Bei den Kritiken reicht das Spektrum von kurzen, manchmal prägnanten, aber meistens zu sehr unter zu langen Inhaltsangaben leidenden Texten, aus denen auch keine wirklich kritische Reflektion des Gelesen erfolgt. ZU oft stellen sich einige der Kritiken und ihre zu persönliche Meinung in den Vordergrund, als wirklich auf das Buch an sich einzugehen. Aus dem persönlichen Empfinden kann man nicht viel ablesen, denn schließlich kennt der interessierte Leser weder den Hintergrund des Rezensenten noch seine Stimmung. Wenn dann auch noch offensichtliche stilistische und inhaltliche Schwächen in einer Kritik herausgearbeitet werden, dass Fazit dann aber doch von einer Lektüre, in einem Rutsch goutiert oder einem unterhaltsam packenden Buch spricht, dann hat man eher das Gefühl, als wenn der Kritiker die Rezensionsbücher gebenden Verlage nicht verärgern wollte. Aus den vielen Besprechungen deutscher und internationaler Bücher scheinen nur wenige Romane herauszuragen, die von den gängigen Trends der Fantasy abweichen und vorsichtig in ein gewisses, unsicheres Neuland vorstoßen wollen. Unterstützt werden die Kurzrezensionen durch die launischen Empfehlungen von Alexander W. Müller. Er stellt einige Roman oft sehr umfangreich vor, bemüht sich nicht nur seine persönlichen Eindrücke – in einer Art Kolumne im Gegensatz zur neutral anzulegenden Rezension empfehlenswert, wenn der Autor wirklich etwas zu sagen hat – zu vermitteln, sondern die Besonderheiten der besprochenen Bücher herauszuarbeiten. Im Gegensatz zu seinem aus meiner Sicht misslungenem Artikel im letzten Jahrbuch wirken die Besprechungen runder und vor allem differenzierter. Weiterhin ergänzen seine Anmerkungen die einzelnen Rezensionen – es gibt nur eine Überschneidung – und die englischen Besprechungen am Beginn des Buches. Die lange Kritik am vierten Teil von George R.R. Martins umfangreicher Fantasy- Serie unter dem bezeichnenden Titel „Vier Jahre für eine Strophe“ von Manfred Roth beweist das Gegenteil. Zu umfangreiche Inhaltswiedergabe und am Ende eine unentschlossene Kritik. Hilflos wirkt der Artikel, wenn Manfred Roth aufzeigt, dass bisherige Reaktionen einzelner Leser leichte Enttäuschung beinhalteten. Der Leser findet aber eher impliziert als wirklich dargestellt Roths Ansichten.
Bei der Artikelfront finden sich mit einem Artikel über Tamora Pierrce – nach der Lektüre kann der Leser nicht entscheiden, was wirklich den Unterschied zwischen dieser Autorin und unzähligen Epigonen ausmacht – und „Wie als Linda Rinda wurde“ von Thomas Gramlich eher durchschnittliche Arbeiten. Unentschlossen und im Gesamtkontext zu inhaltsschwer und kritiklos. Höhepunkt der sekundärliterarischen Beiträge ist sicherlich – auch wenn das Thema auf den ersten Blick wenig begeistert – „Der Arthus Mythos in der Kinder- und Jugendbuchliteratur.“ – ist. Maren Bonacker stellt nicht nur die historischen Wurzeln des Arthus- Mythos vor – hier wird nur von Volksunterhaltung gesprochen – sondern geht auf einige wichtige Werke sehr ausführlich ein. Die einzelnen Entwicklungen zeigt sie sehr konsequent und stringent auf. Leider konzentriert sich die Autoren schließlich auf die leicht erhältlichen Neuerscheinungen und nicht mehr die historischen Werke. Diese stellt sie dann viel zu umfangreich vor und reduziert den Reiz, die Bücher zu kaufen und zu lesen deutlich.
Zwei Interviews von Erik Schreiber mit Heide Solveig Götter und Jonathan Stroud – nur für das Interview hätten die Druckmaschinen angehalten werden müssen, aber nicht für Erik Schreibers vierseitiges Nichts als Einführungsartikel – sind routiniert und gut geführt. Erik Schreiber kennt die Werke der Autoren und geht insbesondere auf Details ein, die Fans einen besseren und tiefer gehenden Einblick in die Entstehungsgeschichte geben. Stellenweise fühlen sich allerdings Nichtleser wie Außenseiter.
Wie die ersten Bände gibt das MAGIRA Jahrbuch wieder einen umfassenden Überblick über das Genre – der Bereich Film ist dieses Mal zugunsten des Hörbuches und vor allem der Musik unterrepräsentiert. Alle Beiträge erreichen zumindest ein durchschnittliches Niveau mit einigen herausragenden Arbeiten. Da es nicht viele Fantasy- Rezensenten gibt, muss Erik Schreiber eine bemerkenswerte Menge von Büchern besprechen. In dieser Konzentration erscheinen allerdings seine Buchbesprechungen eher wie Fließbandarbeit, in denen sich die einzelnen Versatzstücke zu stark wiederholen. Außerdem wirkt er oft zu unentschlossen und zu unkritisch. Trotzdem ist seine Fleißarbeit für dieses Band – inklusiv der Interviews – herauszustellen und zu loben.
Hermann Ritter und andere: "Magira - Jahrbuch der Fantasy 2006"
Sekundärwerk, Softcover, 350 Seiten
Fantasy Club 2006
ISBN 3-9359-1306-0

Leserrezensionen
:: Im Moment sind noch keine Leserrezensionen zu diesem Buch vorhanden ::
:: Vielleicht möchtest Du ja der Erste sein, der hierzu eine Leserezension verfasst? ::
|