|
rezensiert von Thomas Harbach
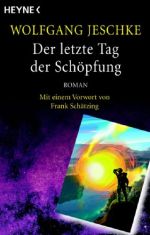 Nach fast fünfundzwanzig Jahren liegt eine bearbeitete Neuauflage von Wolfgang Jeschkes Roman „Der letzte Tag der Schöpfung“ in seinem Hausverlag Heyne vor. Während einer erste oberflächliche Lektüre beunruhigende Assoziationen zur gegenwärtigen politischen Lage weckt, negiert Wolfgang Jeschke diesen prophetischen Eindruck in seinem ruhigen, aber informativen Nachwort. Sein Roman ist 1977 fertig gestellt worden und erschien einige Zeit später als Hardcover. Damit ist das Werk unmittelbar ein Kind der Ölkrise – und diese steht in keinem Zusammenhang mit den immer stärker steigenden Ölpreisen. Neben einer stetig steigenden Nachfrage an den Weltmärkten aus Asien basiert ein Teil dieses Preisanstieges auf Fehlspekulation und vor allem fehlenden Raffineriekapazitäten. Es nützt nichts, Öl aus der Erde zu holen, wenn der Rohstoff nicht verarbeitet werden kann. Jeschke begeht nicht den Fehler, seinen Roman so grundsätzlich zu aktualisieren. Es finden sich auch keine Anspielungen auf islamistischen Terror, sondern Jeschke kalkuliert kühl eine Konfrontation zwischen erdölfördernden Ländern und dem Verbraucher – eben so den USA in den siebziger Jahren – durch. Das inzwischen ein Teil des Preisdrucks durch die stetig industriell wachsende Volksrepublik China kommt und fundamentalistische Terroristen dazu kommen sind, ist eine Tatsache, die nur mit wirklich willkürlicher Interpretation in den Text integriert werden kann. So gehen auch die arabischen Gegner in erster Linie mit einer angeheuerten Söldnertruppe und russischen Militärberatern gegen die unterlegene amerikanische Armee vor. Die Ausgangsposition des Romans lässt nur einen weiteren interessanten Spekulationsaspekt zu: hat Jeschke das ungeplante Verhalten der amerikanischen Armee nicht auch unter dem Eindruck der Niederlage in Vietnam geschrieben? Dort wurde ebenfalls der Gegner maßlos unterschätzt, während die brutalen Kriege der neunziger Jahre trotz der im Irak agierenden Untergrundkämpfer eher von einer Overkillperspektive aus angegangen worden sind. So modern Jeschkes Roman auf den ersten Blick noch wirkt, ist er ein Kind der politisch ebenfalls sehr unruhigen siebziger Jahre.
Nach fast fünfundzwanzig Jahren liegt eine bearbeitete Neuauflage von Wolfgang Jeschkes Roman „Der letzte Tag der Schöpfung“ in seinem Hausverlag Heyne vor. Während einer erste oberflächliche Lektüre beunruhigende Assoziationen zur gegenwärtigen politischen Lage weckt, negiert Wolfgang Jeschke diesen prophetischen Eindruck in seinem ruhigen, aber informativen Nachwort. Sein Roman ist 1977 fertig gestellt worden und erschien einige Zeit später als Hardcover. Damit ist das Werk unmittelbar ein Kind der Ölkrise – und diese steht in keinem Zusammenhang mit den immer stärker steigenden Ölpreisen. Neben einer stetig steigenden Nachfrage an den Weltmärkten aus Asien basiert ein Teil dieses Preisanstieges auf Fehlspekulation und vor allem fehlenden Raffineriekapazitäten. Es nützt nichts, Öl aus der Erde zu holen, wenn der Rohstoff nicht verarbeitet werden kann. Jeschke begeht nicht den Fehler, seinen Roman so grundsätzlich zu aktualisieren. Es finden sich auch keine Anspielungen auf islamistischen Terror, sondern Jeschke kalkuliert kühl eine Konfrontation zwischen erdölfördernden Ländern und dem Verbraucher – eben so den USA in den siebziger Jahren – durch. Das inzwischen ein Teil des Preisdrucks durch die stetig industriell wachsende Volksrepublik China kommt und fundamentalistische Terroristen dazu kommen sind, ist eine Tatsache, die nur mit wirklich willkürlicher Interpretation in den Text integriert werden kann. So gehen auch die arabischen Gegner in erster Linie mit einer angeheuerten Söldnertruppe und russischen Militärberatern gegen die unterlegene amerikanische Armee vor. Die Ausgangsposition des Romans lässt nur einen weiteren interessanten Spekulationsaspekt zu: hat Jeschke das ungeplante Verhalten der amerikanischen Armee nicht auch unter dem Eindruck der Niederlage in Vietnam geschrieben? Dort wurde ebenfalls der Gegner maßlos unterschätzt, während die brutalen Kriege der neunziger Jahre trotz der im Irak agierenden Untergrundkämpfer eher von einer Overkillperspektive aus angegangen worden sind. So modern Jeschkes Roman auf den ersten Blick noch wirkt, ist er ein Kind der politisch ebenfalls sehr unruhigen siebziger Jahre.
Die Idee, den Arabern einen Teil ihres Öls über eine in prähistorischen Zeiten gelegte Pipeline, abzupumpen, ist der Ausgangspunkt Jeschkes Zeitreiseroman. Minutiös beschreibt er in der ersten Hälfe des Buches die augenscheinlich perfekte Vorbereitung der amerikanischen Militärs und die Ausbildung der einzelnen, aus Segmenten der Army, aber auch von privaten Firmen rekrutierten Spezialisten. Kaum in der Vergangenheit gelandet, konzentriert sich der Autor auf eine eingeschränkte Perspektive. Durch die Augen des Beinahe Astronauten Steve Stanley taucht der Leser in eine chaotische, aus jeglichen Fugen der Vernunft geratene Welt ein. Die arabischen Nationen – im Gegensatz zu den Amerikanern vermeidet Jeschke, hier Nationalitäten zu nennen, er bleibt seltsam vage – haben sich mit Hilfe russischer Technologie und in erster Linie westeuropäischer Söldner weiter in die Vergangenheit begeben und ihre Stützpunkt errichtet. Jetzt machen sie Jagd auf die amerikanischen Truppen und es gelingt ihnen immer öfter, die verwirrten Feinde direkt nach der Materialisation – eine der beeindruckenden Szenen des Romans – anzugreifen und zu töten. Auch wenn die Szenen mit dem MIG 25 in der Steinzeit eindrucksvoll und cineastisch wirken, stellt sich die Frage, wie viel Energie zum Versand dieser Maschinen wirklich notwendig ist und ob die arabische Nation ohne Kenntnis der amerikanischen Geheimdienste ein solches Szenario wirklich aufrechterhalten könnten. So ist auch die Konstellation, dass bei den Arabern alles und bei den Amerikanern nichts klappt, eher linkspolitisch motiviert als einleuchtend. Allerdings beschreibt Jeschke die Actionszenen sehr überzeugend und lässt seinen Lesern nicht die Luft, über viele lose Fäden nachzudenken.
Stanley begegnet nicht nur den Söldnern und verstreuten, ums Überleben kämpfenden Amerikanern. Die Uhreinwohner sind zu einer Art Armee zusammengezogen worden. Mit satirischen Seitenhieben nimmt der Autor sehr gekonnt die unterschiedlichen disziplinarischen Vorstellungen bis hin zur klischeehaft überzogenen standrechtlichen Erschießung aufs Korn. Die Problematik dieser Teile des Romans liegt in der mangelnden, fast nicht vorhandenen Charakterisierung der einzelnen Charaktere. Wenn es zu rührenden, durch die Zeit verzerrten Wiedersehenszenen kommt, nimmt es der Leser weder den einzelnen Protagonisten, noch dem Autoren mit vollem Herzen ab.
Auch wenn Jeschke mit dem Thema Zeit besser umgehen kann, als viele seiner Mitautoren und geschickt Anspielungen auf andere Autoren dieser Zunft – Silverberg und Lafferty – einfließen lässt, stellen sich verschiedene Fragen: Warum hinterlässt keiner der Amerikaner eine wirklich ernsthafte Botschaft an die Zukunft? Die Wissenschaftler und Geheimdienste der amerikanischen Armee haben inzwischen genaue Kenntnisse, dass in der Vergangenheit eine Operation stattgefunden hat. Neben den Pipelineresten finden sich Spuren eines Jeeps in der Nähe des Felsen von Gibraltar und teilweise menschliche Überreste. Die erste Mission der entsandten Soldaten hätte das Vergraben von Zeitbotschaften an bekannten und vorgegebenen Stellen sein müssen. Mit dieser Idee wird nur kurz und oberflächlich gespielt. Das Stücke diese große Zeit überstehen können, haben die Funde bewiesen.
Dann entwickelt Jeschke eine Reihe von Parallelweltszenarien. Viele Zeitreisende scheinen in den Verlauf der Geschichte eingegriffen zu haben. Eine der Kommandanten des amerikanischen Stützpunkts schreibt diese Abzweigungen in der Zeit auf. Dazu kommen die wenigen persönlichen Begegnungen mit Soldaten des Herrn, auf die später noch eingegangen werden soll. Die Frage stellt sich, warum haben die Amerikaner nicht weitere Operation gestartet und direkt in die arabische Geschichte eingegriffen? Wenn sie über die Möglichkeit der Zeitreise verfügt haben, wäre ein militärischer Eingriff in den vierziger Jahren des 20. Jahrhunderts zusammen mit der Gründung des Staates Israel ein weiteres, sehr interessantes Ziel gewesen. Dann gäbe es keine arabische, ölbetriebene Großmacht, die auf die Möglichkeit der Zeitreise zurückgreifen könnte.
Die einzige Macht, die über eine umgekehrte Zeitreise – also von der Vergangenheit in die Gegenwart oder Zukunft – verfügt, ist wahrscheinlich eine kirchliche Organisation. Mit dieser Anspielung schließt sich der Kreis zu Jeschkes neuem Roman „Das Cusanus Spiel“, in welchem die Kirche die inzwischen durch ökologische Katastrophen schwer bewohnbare Erde der nahen Zukunft, wieder besähen möchte. Auch in diesem älteren Werk scheint die Kirche über die einzige Möglichkeit einer ausgereiften Technologie zu verfügen. Sie schickt einen Märtyrer in die Vergangenheit, der sich trotz überlegener Technologie in den Kampf stürzt. Die Leser begegnen einem weiteren Kirchenvertreter in einer eher ironisch angelegten und dann abgebrochenen Szene gegen Ende des Buches. Dabei verzichtet Jeschke auf jegliche Spekulation mit der potentiellen Ausgangsrealität. Im Gegensatz zu einer Reihe von Texten begnügt er sich, durch die historische Manipulation oberflächlich mit der Zeit zu spielen. Ob sich der Zeitstrom wieder beruhigt, lässt der Autor qualvoll offen. Sein Protagonist zieht sich in die Wiege der Menschheit – Afrika – zurück, um den göttlichen Schöpfungsprozess zu verfolgen. Eine simple, ergreifende Lösung eines über weite Strecken actionreichen und packenden Buches.
Der Roman zerfällt im Grunde in drei Teile: der fragmentarische Auftakt mit den Funden aus der Vergangenheit, der geheimnisvollen Anwerbung von „freiwilligen Rekruten“ und die Beschreibung des „Chronotron-Projektes“. Mit bissiger und spitzer Feder entlarvt Jeschke die Planer militärischer Operation als egoistische Lügner. Erstaunlicherweise geht er mit keinem Wort auf den oft von Soldaten geforderten Patriotismus ein und das Sterben für das Vaterland. Vielleicht liegt es in der Tatsache begründet, dass seine Expedition in die Vergangenheit ein gemischtes Team aus Spezialisten und Soldaten erfordert.
Im Mittelteil schildert er ebenfalls bruchstückhaft und wie für alle Kriege exemplarisch chaotisch die einzelnen Kriegsschauplätze. Die Mission wird auf den Drang des Überlebens reduziert. Geschickt hat er die Atlantislegende eingeflochten. Das er auch mit den Theorien Erich von Dänikens spielt, wirkt überflüssig und wirft zu viele Fragen auf. Das Ende des Romans ist das schwächste Glied der Handlung. Warum Stanley nicht auf den kirchlichen Krieger wartet, der indirekt seine Bereitschaft bekundet hat, den Amerikaner in eine fremde Zukunft mitzunehmen, ist eine der zu offenen Fragen. Charakterlich interessanter hätte es gewirkt, Stanley das Angebot des Unbekannten ablehnen zu lassen, damit er auf seiner „göttlichen“ Mission zum Ursprung der Menschen weiterpilgern kann. Wie in seinem späteren Werk ist Jeschke in Bezug auf die Motivation und Charakterisierung seiner einzelnen Personen zu vorsichtig vorgegangen.
Trotz oder gerade wegen einer Reihe von Schwächen ist der Roman ein auch heute noch interessantes Werk. Jeschke beschreibt zwar die menschliche Ignoranz und entlarvt den blinden Fortschrittsglauben, aber der Leser darf auf keinen Fall die extrapolierten Konflikte der Vergangenheit – der siebziger Jahre – als Maßstab einer trotz der zur Zeit vorherrschenden aggressiven Expansionspolitik zweier Weltmächte – die Chinesen verpacken ihr Streben im Vergleich zu den Amerikanern nur geschickter – der Gegenwart nehmen. In seinem Roman verbreitet Jeschke die Botschaft, dass ein Miteinander immer der bessere Weg ist und das Waffen/Militär eine Sackgasse und keine Lösung darstellen. Diese Botschaften sind wahrlich zeitlos, wenn auch an einigen Stellen Jeschkes Wille nicht seinen eigenen literarischen Ansprüchen genügt oder genügen kann.
Wolfgang Jeschke: "Der letzte Tag der Schöpfung"
Roman, Softcover, 316 Seiten
Heyne 2005
ISBN 3-4535-2121-8

Leserrezensionen
:: Im Moment sind noch keine Leserrezensionen zu diesem Buch vorhanden ::
:: Vielleicht möchtest Du ja der Erste sein, der hierzu eine Leserezension verfasst? ::
|