|
 Victor
Hugo - 200-Jahrfeier eines europäischen Superstars Victor
Hugo - 200-Jahrfeier eines europäischen Superstars
Geboren am
26. Februar 1802 in Besançon (Frankreich), gestorben am 22. Mai 1885 in
Paris.
"Ein komisches Volk, diese Franzosen", notierte Edmond de Goncourt
am 22. Mai 1885 in ungewohnt salopper Art in sein Tagebuch. "Sie
wollen keinen Gott mehr, sie wollen keine Religion mehr, und da sie nun
gerade Christus entgöttert haben, vergöttern sie im selben Moment Hugo
und proklamieren die Hugolatie." Victor Hugo war gerade verstorben und
Frankreich erstarrte wie in Trauer um ein geliebtes Staatsoberhaupt. Die
Beisetzung des Schriftstellers geriet zu einem nationalen Großereignis,
das in einem symbolischen Akt schließlich und endgültig das Hin und Her
um Soufflots Kirchenbau auf dem Hügel Sainte-Geneviève beendete: Die Kirche,
die mit der Beisetzung Voltaires 1791 durch die Revolution zum nationalen
Mausoleum bestimmt worden war, im Laufe der wechselnden Regimes des 19.
Jahrhunderts dann teils religiösem, teils patriotischem Kult gedient hatte,
wurde nun, mit dem Einzug von Victor Hugos Leichnam, unwiderruflich zur
Nekropole der Großen Frankreichs: Aux Grands Hommes la Patrie reconnaissante.
Woher kam
sie, diese Reconnaissance, Dankbarkeit und Anerkennung, die bis
heute Hugos Ruhm ausmachen? Wie kam es, dass Hugo im Gegensatz zu den
Bohémiens des 19. Jahrhunderts bereits zu seinen Lebzeiten Prominenz,
Respekt und Reichtum erlangte? Warum wurde bereits Hugos 80. Geburtstag,
drei Jahre vor seinem Tod, zu einem nationalen Feiertag, an dem französischen
Schülern alle Strafen erlassen wurden und die Straße, in der Hugo wohnte,
zur Avenue Victor Hugo umbenannt wurde, so dass man "An Monsieur
Victor Hugo, in seiner Avenue" schreiben konnte? Dazu brauchte es Genie,
Ehrgeiz, vielseitiges Engagement und eine schillernde Persönlichkeit.
Der Franzose
Die Geschichte dieses Mannes, der am 26. Februar 1802 in Besançon das
Licht der Welt erblickte, ist eng mit der Frankreichs verstrickt. Der
junge Hugo unterlag zunächst den gegensätzlichen Einflüssen seiner Eltern:
Sein Vater war Anhänger der Revolution und stieg im Empire bis zum Rang
eines Generals auf. Seine Mutter hingegen war Royalistin, und da Napoleon
durch die Versetzungen des Vaters das Familienleben nachhaltig beeinträchtigte,
die Eltern ohnedies bald getrennt lebten, galt auch Victor Hugos Loyalität
während der Restauration uneingeschränkt den Bourbonen. Dies war entscheidend
für die Laufbahn Hugos, denn die gegenseitige Sympathie zwischen dem jungen
Dichter und dem Regime ermöglichte es ersterem, sein ehrgeiziges Ziel
"Chateaubriand ou rien!" mit Nachdruck zu verfolgen: Hugo bekam
eine staatliche Rente, mit deren Hilfe er sich trotz früher Familiengründung
uneingeschränkt seiner schriftstellerischen Tätigkeit widmen konnte. Dank
des großen Arbeitseifers ließen Erfolge nicht lange auf sich warten und
die Einstellungen veränderten sich. Sowohl in politischer als auch in
literarischer Hinsicht wurde Hugo zum Liberalen und die skandalumwitterte
Uraufführung des Dramas "Hernani" im Revolutionsjahr 1830 machte
ihn zum Kopf der französischen romantischen Schule, deren Mittelalterbegeisterung
in "Notre Dame de Paris" 1831 zur vollen Entfaltung kam.
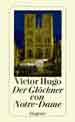 Es
ist dieses innovative, wenn nicht revolutionäre Flair, das Hugo seit 1830
bereits umgab, durch das Exil unter Napoleon III. bestätigt wurde und
sich durch das Engagement 1870/71 unauslöschlich in das kollektive Gedächtnis
einprägte, das Hugo zur Ikone zunächst der Dritten Republik und heute
offenbar auch der Fünften Republik werden lässt: Reconnaissance
- republikanischer Stolz also auf Leben und Werk einer Legende. Auf der
anderen Seite spielt aber auch die Bewunderung für die Menschlichkeit
dieses Mannes eine Rolle, der auf typisch französische Weise Konkflikten
kompromissbereit und persönlichen Widersprüchen gelassen begegnete. Schließlich
war doch der große Liberale zu Hause ein zutiefst bürgerlicher Patriarch,
der im Interesse des Familienlebens von seiner Frau und seinen Geliebten
Treue und Ergebenheit erwartete. Dass die diesbezügliche Autorität Hugos
seiner Frau zur Last - Adèle flüchtete sich in eine Romanze mit Hugos
Kritiker und Konkurrent Sainte-Beuve - und seiner Tochter zum Verhängnis
- die junge Adèle H., wie François Truffaut sie in seiner Verfilmung diskret
bezeichnete, konnte sich nie aus dem Schatten des Vaters in ein eigenes
Leben befreien und erlitt ein tragisches Schicksal, das der Vater nicht
besser hätte erfinden können - wurde, verzieh man dem Familienvater, der
mit dem Verlust seiner übrigen Kinder schon schwer gestraft schien. Es
ist dieses innovative, wenn nicht revolutionäre Flair, das Hugo seit 1830
bereits umgab, durch das Exil unter Napoleon III. bestätigt wurde und
sich durch das Engagement 1870/71 unauslöschlich in das kollektive Gedächtnis
einprägte, das Hugo zur Ikone zunächst der Dritten Republik und heute
offenbar auch der Fünften Republik werden lässt: Reconnaissance
- republikanischer Stolz also auf Leben und Werk einer Legende. Auf der
anderen Seite spielt aber auch die Bewunderung für die Menschlichkeit
dieses Mannes eine Rolle, der auf typisch französische Weise Konkflikten
kompromissbereit und persönlichen Widersprüchen gelassen begegnete. Schließlich
war doch der große Liberale zu Hause ein zutiefst bürgerlicher Patriarch,
der im Interesse des Familienlebens von seiner Frau und seinen Geliebten
Treue und Ergebenheit erwartete. Dass die diesbezügliche Autorität Hugos
seiner Frau zur Last - Adèle flüchtete sich in eine Romanze mit Hugos
Kritiker und Konkurrent Sainte-Beuve - und seiner Tochter zum Verhängnis
- die junge Adèle H., wie François Truffaut sie in seiner Verfilmung diskret
bezeichnete, konnte sich nie aus dem Schatten des Vaters in ein eigenes
Leben befreien und erlitt ein tragisches Schicksal, das der Vater nicht
besser hätte erfinden können - wurde, verzieh man dem Familienvater, der
mit dem Verlust seiner übrigen Kinder schon schwer gestraft schien.
Der Europäer
Neben dem republikanischen Patriotismus sind es die europäischen Visionen,
die die Persönlichkeit von Victor Hugo heute attraktiv machen. Während
des Exils entwickelte er bereits die Idee einer gemeinsamen europäischen
Währung. Am 14. Juli 1870, Jahrestag des Sturmes auf die Bastille und
Vorabend des deutsch-französischen Krieges, pflanzte er in seinem Garten
auf Guernesey die Eiche der Vereinigten Staaten von Europa und prophezeite,
dass es in hundert Jahren keine Kriege und keinen Papst mehr geben, die
Eiche aber groß sein würde. ( Der Schriftsteller und Hugo-Biograph André
Maurois stellte 1954 lakonisch fest, dass sich bis dahin nur die letzte
der Prophezeiungen bewahrheitet habe.) Kurz darauf kehrte er pflichtbewusst
nach Paris zurück, um seinen Landsleuten in den bevorstehenden schwierigen
Zeiten zur Seite zu stehen und die am 4. September proklamierte Dritte
Republik aktiv zu unterstützen, die große Hoffnungen in die Rückkehr des
großen Schriftstellers legte.
Deutschland,
dessen Landschaft und Kultur Hugo nicht zuletzt während seiner Rheinreisen
(1838-40) schätzen gelernt hatte, bedachte er zunächst mit einem wohlwollenden
Appell voller Unverständnis über die Entwicklung zwischen den beiden Nationen,
die seines Erachtens Europa bildeten. Die anhaltende Belagerung der Stadt
Paris, die an den unfriedlichen Zielen der Preußen bald keinen Zweifel
mehr ließen, zwang Hugo dann jedoch zu patriotischen und unverhohlen martialischen
Tönen.
Der Dichter
und Volksschriftsteller
 Faszinierend,
aber auch suspekt, war seit jeher das Multitalent Victor Hugos, dessen
Werk alle Gattungen umfasst: Bändefüllende lyrische Dichtungen, die alle
Facetten des politischen und persönlichen Lebens mit kraftvollen Worten
beschworen und dem Schriftsteller mit unbeirrbarer rhythmischer Sicherheit
in einem Maße aus der Feder flossen, das sogar Vorratshaltung und somit
auch bei reduzierter Schaffenskraft stetige Veröffentlichungen erlaubte.
Dramen solcher Superlative, dass sie, wie "Cromwell", dessen
programmatisches Vorwort berühmt wurde, nie zur Aufführung gelangen konnten.
Romane, die ebenfalls die bildungstheoretischen und gesellschaftskritischen
Ambitionen des Autors illustrieren und noch dazu der zeitgenössischen
Lust am Phantastischen und Grauenhaften Rechnung tragen. Die Geschichten
von Quasimodo und Esmeralda aus "Notre Dame de Paris" oder Jean
Valjean und Cosette aus "Les Misérables" kennt jeder und haben,
will man einer Definition von Michel Tournier folgen, das Zeug zum Mythos.
Dies verdanken wir Menschen wie Walt Disney und Andrew Lloyd Webber, weniger
der Tatsache, dass Hugo heute tatsächlich gelesen wird. Faszinierend,
aber auch suspekt, war seit jeher das Multitalent Victor Hugos, dessen
Werk alle Gattungen umfasst: Bändefüllende lyrische Dichtungen, die alle
Facetten des politischen und persönlichen Lebens mit kraftvollen Worten
beschworen und dem Schriftsteller mit unbeirrbarer rhythmischer Sicherheit
in einem Maße aus der Feder flossen, das sogar Vorratshaltung und somit
auch bei reduzierter Schaffenskraft stetige Veröffentlichungen erlaubte.
Dramen solcher Superlative, dass sie, wie "Cromwell", dessen
programmatisches Vorwort berühmt wurde, nie zur Aufführung gelangen konnten.
Romane, die ebenfalls die bildungstheoretischen und gesellschaftskritischen
Ambitionen des Autors illustrieren und noch dazu der zeitgenössischen
Lust am Phantastischen und Grauenhaften Rechnung tragen. Die Geschichten
von Quasimodo und Esmeralda aus "Notre Dame de Paris" oder Jean
Valjean und Cosette aus "Les Misérables" kennt jeder und haben,
will man einer Definition von Michel Tournier folgen, das Zeug zum Mythos.
Dies verdanken wir Menschen wie Walt Disney und Andrew Lloyd Webber, weniger
der Tatsache, dass Hugo heute tatsächlich gelesen wird.
"Ob
das Trommeln für Hugo bewirkt, dass der Staub von manchen seiner Bücher
fliegt?" fragte daher auch Gregor Dotzauer am 24. Februar 2002 im "Tagesspiegel".
Das darf man bezweifeln, denn Hugos Bücher sind selten zeitlos, so dass
ihr Verständnis ohne (literatur-)historisches Hintergrundwissen bereits
für Hugos Landsleute schwierig ist. In Frankreich gehört die Kenntnis
ausgewählter Hugoscher Gedichte freilich noch zur besseren Schulbildung,
in Deutschland hingegen geht Hugo-Lektüre längst weit über die Allgemeinbildung
hinaus und wird auch in den frankophilsten Schulen von Französischlernern
nicht mehr verlangt. Diesbezüglich bezeichnend ist die Editionslage von
Hugos Werk diesseits des Rheines, die sich auch zum 200. Geburtstag offenbar
nicht wesentlich gebessert hat.
Friderike
Beyer
© TourLiteratur
/ Autorin
Alle Rechte vorbehalten
Foto Victor
Hugo: © Archiv Diogenes Verlag, Zürich
Benutzung mit freundlicher Genehmigung des Diogenes
Verlags, Zürich
Buchcover:
1) Victor Hugo: Der Glöckner von Notre Dame. Taschenbuch. Diogenes
Verlag Zürich
2) Victor Hugo: Die Elenden - Les Misérables. Artemis & Winkler
Verlag, München 1998
 Weiterführende
Links zu Victor Hugo
Weiterführende
Links zu Victor Hugo
Zwei
Buchempfehlungen

Jörg W. Rademacher
Victor Hugo
München: dtv 2002
191 Seiten
Preis: 10,00 Euro |

Karlheinrich
Biermann
Victor Hugo
Reinbek: Rowohlt Verlag 1998
(rowohlts bildmonographien)
158 Seiten
Preis: 6,50 Euro |
|