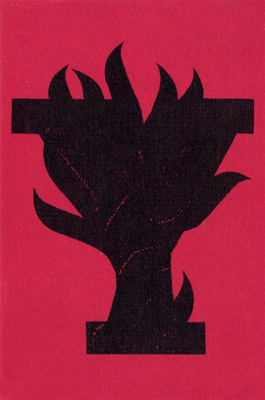|
Roman Santeler, Landecker Hefte
Bozen: Edition Raetia 2010
Kafkas Wort an Oskar Pollack aus dem Jahr 1904 "Ein Buch muß die Axt sein für das gefrorene Meer in uns" ist, obwohl nun schon über hundert Jahre alt, noch immer so treffend und präzise wie kaum eine andere Definition von guter Literatur. Auf dem kürzesten aller Wege, in einem Satz, definiert es die Absicht des Schreibenden (zu treffen) sowie die dazu nötige Haltung des Lesers (des gefrorenen Meeres in sich bewusst zu sein). Kafkas Satz macht im Grunde eine Rezension zu Santelers Landecker Heften überflüssig: er hat die nötige Prägnanz, die äußerste Knappheit, die Erfahrung von Kälte, die alle nötig sind, um den spezifischen Ton von Santelers Gedichten, Notizen und Tagebuchaufzeichnungen zu beschreiben. Er deutet z.B., besser als jede lange Erklärung, die Stellung des Sängers, sein Stehen auf verlorenem Posten, nicht nur in der herben Landschaft des oberen Inntals, sondern vermutlich allerorten:
Kammerton (S. 81)
Wenn du hinausgehst
überleg dir zweimal, was du sagst
du kämpfst gegen Windmühlen
stumpf sind
deine Waffen
für den Notfall
gebe ich dir eine Stimmgabel mit
aber besser, du schweigst
Sänger.
Auch in Günter Kunerts Frankfurter Vorlesungen aus dem Jahr 1985 (Vor der Sintflut, Das Gedicht als Arche Noah) finden sich Passagen, die sich als Deutungen zu manchen Santeler-Gedichten lesen. So sagt Kunert vom Gedicht: … Seine Sache ist die Verstörung. Wenn der Leser, der das Gedicht mehr oder weniger intensiv nachvollzieht, sich um sein Leben betrogen fühlt, seiner Möglichkeiten und Chancen beraubt; wenn das Gedicht sein Einverständnis mit der Welt erschüttert, dann hat es eine Leistung vollbracht, die für ein derart winziges Gebilde aus wenigen Zeilen gigantisch ist. (Vor der Sintflut, S.52). Im Falle der Landecker Hefte heißt das, dass es ihnen gelingt, dem Leser ihre Sicht zu vermitteln: die Erfahrung des Fremdseins im Fischteich (Frage S. 80), die extreme Wortkargheit ringsum, die unterkühlte Kommunikation zwischen den Menschen, die vielstimmige, schrille Sprachlosigkeit (Zur Kirschblütenzeit S. 41, Manna S. 59), das Unterschreiten eines Minimums an Nähe (Landeck, S. 17), atemraubende Einsamkeit (Bescheid S. 16), Geheimnisse statt Gespräche, die schwere Last, Geheimnisse zu tragen (Verschwiegenheit S. 82), das Dröhnen des finsteren Inns und leerer Worte, äußere und innere Türme zu Babel (Du S. 50 ), das Schweigen Gottes (Im Gotteshaus S. 84), die letzte Stille (Silentium S. 87).
Immer wieder fühlt sich der Leser wie Kaspar Hauser: um den Dialog mit dem Text betrogen, weil dieser auf Verständnis aufbauen müsste; die Gedichte entziehen sich dem logischen Zugriff oft kraft ihrer extremen Kargheit, die die Grenze zum einfachen Textverständnis wiederholt und gezielt unterschreitet. Der Leser bleibt draußen, Ante portas (S. 85), unerwünscht. Er bleibt ein Kaspar Hauser, eine Lektüre lang. Er erfährt Kaspar Hausers Verzweiflung, dessen Sprache nie an die der Anderen heranreichte. Die Landecker Hefte sind das Sprachrohr eines Kaspar Hausers, der nicht anders kann als die Mangelhaftigkeit der Sprache ringsum zu spiegeln. Seine Spiegelfunktion macht ihn unerträglich:
In euren Augen (S. 64)
immer werde ich
ein armer Kaspar Hauser sein
aus der Stadt
verjagt
mundtot gemacht.
Die Landecker Hefte (Edition Raetia, 2010) sind zwei in einem Band zusammengeführte Textsammlungen von ungefähr gleichem Umfang: 1. Glückliche Zeiten und 2. Silentium.
Das Eingangsgedicht schlägt eine Tonart an, die weite Teile des Bandes bestimmen wird:
Exit (S.15)
Letzte Ausfahrt:
Stanzer Tal, Paznaun,
Oberes Gericht.
Herr,
sei mir gnädig –
ich bin nicht Hiob.
Es markiert vielleicht den Beginn einer Lebensphase, eine Etappe hin zu einem ungewissen Ausgang, es ist eine Verurteilung, das Gericht so undefiniert wie in Kafkas „Prozess“. Wer kennt Hiobs Schuld, das Ausmaß seines Leidens? Keine Andeutung auf späteres Glück, nur Angst, auch dafür keine Erklärung, nur weißes Papier ringsum. Äußerste sprachliche Zurücknahme: unverständliche geographische Angaben, ein verschwiegenes Ziel, ein Stoßgebet.
Und doch: dieses Stoßgebet steht zu Beginn der Glücklichen Zeiten. Der Leser hält sich ans titelgebende Glück und liest weiter. Er tut dies, obwohl das Gedicht keine Mutmaßungen zulässt. Wie ein Fremder nimmt der Leser die letzte Ausfahrt, biegt ein in ein herbes, ihm unbekanntes Tal. Noch bevor er ankommt, zieht das Tal, d.h. das Gedicht, die Tür vor ihm fest zu. In die sprachliche Oberfläche transportiert Santeler sehr gekonnt das schroffe Schweigen des Paznauntals, die unheilvolle Präsenz eines Oberen Gerichts, das Schweigen Gottes. Das Schweigen, die Erfahrung der Beklemmung, die Sehnsucht nach Weitung und Wärme, werden im gesamten Gedichtband präsent bleiben, aber sie werden um sanftere, hellere Nuancen erweitert werden: so offenbart sich das Schweigen manchmal sogar als unterdrückter Glücksschrei …
Nachricht (S. 33)
So ist mir zumute:
laut in den Himmel schreien
ich liebe dich
dass die Kraniche
es dir zutragen.
… oder auch als scheue, zarte Aufforderung, hinzuschauen, wo Worte unmöglich sind …
Königsblau (S.38)
Sieh mich an –
auf und auf bin ich
voller Farbe
ein offenes Buch.
Die Gedichte Nachricht und Königsblau befinden sich im Teil Glückliche Zeiten: sie sind, versteht der Leser plötzlich, Erklärung genug, Hiobs Schicksal hat sich bereits gewendet.
… oder auch als Gottes schwer zu entschlüsselnde, trotzdem Licht spendende Sprache …
Im Gotteshaus (S. 84)
Hier bist du,
hier musst du sein –
ich nehme die Sprache
beim Wort
zurückgezogen
verbirgst du dich
im eigenen Anfang
und schweigst
ich lausche, atme
Licht fällt ein
die Hoffnung so
so groß
als wär‘ der Himmel offen.
Dieses Gedicht steht im 2. Landecker Heft, in Silentium: hier mündet der Weg des eben noch Anreisenden in eine andere Dimension des Schweigens: es ist die wohltuende Stille eines heiligen Ortes, des spirituellen Vertrauens (Verschwiegenheit S. 82), des Meeresgrundes, zu dem sich, gegen Abend hin, unsere Seele neigt (Abend S. 86, Silentium S. 87).
Das 2. Gedicht des Bandes (Bescheid S. 16) nimmt indes Bezug auf Tomis und Worronesch und damit einerseits auf den römischen Dichter Ovid, der die traurigen Jahre seiner Verbannung im unwirtlichen Tomis am Schwarzen Meer verbringen musste, inmitten unkultivierter Menschen, die ihm dem Eisernen Zeitalter zu entstammen schienen, andererseits auf den russischen Dichter Ossip Mandelstam, der von 1934–38 in Worronesch in der Verbannung leben musste. Gefesselt an einen locus horribilis, erinnert sich das lyrische Ich an berühmte Leidensgefährten, denen als einziger „Exit“ die geschriebene Sprache blieb. Das Exil des lyrischen Ichs heißt Landeck (S. 17), seine Enge gleicht einem Nadelöhr, über der Enge der Herzen (Am Gehsteig / kommen wir uns am nächsten) erübrigt sich jeder Kommentar. Und so wird Kreuzgasse 9, Zimmer 407 (S. 18) als Gegenstück zu Günter Eichs berühmten Gedicht Inventur verständlich: eine Bestandsaufnahme am Nullpunkt der Existenz, ein Auflisten dessen, was übrigbleibt nach einem Kahlschlag:
…
Und für die Nacht:
Mitgebrachte Bücher,
Papier und Bleistift.
Ich muss ins Geschehen eingreifen.
Wenn ich dich
Vom Fenster aus sehe,
werde ich dir zurufen.
Übrigbleibt der Wille, einzugreifen, zuzurufen, mit der Kraft der Worte.
Und hier, so scheint’s, beginnen auch die wahrhaft Glücklichen Zeiten: es folgt das titelgebende Gedicht (Für René und Sabine).
Unmittelbar darauf jedoch der Einbruch:
Sanna (S. 20)
Kaum geboren
schon gestorben
hilft der schönste Name
nichts.
Ein vierzeiliges Epitaph, in gebrochenen Versen, für ein Kind. Wiederum erweist sich Santeler als ein Meister im Zeigen der vielen Facetten von sprachlicher Knappheit: in diesem Falle setzt er sie als die einzig richtige Sprachgeste ein.
Und auch sonst sind die Glücklichen Zeiten stets bedroht: von der inneren Isolation, der Sprachnot; Begegnungen erweisen sich als Vergegnungen im Buberschen Sinne(Begegnung S. 21) (keine Notiz nehmt ihr / offen steht mein Haus / an der Landstraße …). Das Gedicht vermittelt die beklemmende Erfahrung versäumter Begegnungen (Fernab zieht / die Karawane vorbei …); unfähig, hinauszulaufen, die Karawane einzuholen, verharrt das lyrische Ich wie gelähmt still in seinem Haus. Sein offenes Haus erweist sich als zu leise Botschaft; wer gesehen werden will, muss sich zeigen … Das zu zaghaft sich öffnende Ich fällt zurück in die Enttäuschung, wie verloren in der Weite des Weltraums.
Immer klarere zeigt sich auch, dass die Klage nicht nur dem Schweigen gilt, das das Ich umgibt (die stumme Landschaft, die mundfaulen Menschen). Die Klage ist subtiler. Lautes gäbe es ja genug: Trosse, stimmenerfüllte Türme zu Babel … was fehlt, das sind die leisen Töne, Augen, die offene Türen wahrnehmen, die Einladungen sehen, selbst wo sie nicht formuliert werden, die sich nur in Gesten offenbaren, weil der Einladende selbst sich verbirgt. Immer deutlicher mutiert die An-Klage in die Klage des lyrischen Ichs über das eigene Schweigen, über die eigene große Angst, einen Schritt zu setzen, durch falsche Schritte Lawinen loszutreten (Wintereinbruch S. 23). Derselben starrkalten Stimmung ist auch das Gedicht Frost (S. 24) verpflichtet, dem tatenlosen Warten, das Frösteln springt den Leser an …
Frost (S. 24)
Darauf
wartest du,
dass Tauwetter kommt.
Hier, auf der Baustelle,
bin ich der Kälte
ausgesetzt
bis in die Haarspitzen.
Manche Gedichte sind gleichermaßen still wie herzzerreißend. Zu ihnen zählt Im 56. Jahr (S. 27f.), eine melancholische, ruhige Lebensbilanz, oder auch Regionalzug Telfs-Landeck (S. 29f.), wo sich die Verse finden: von Schönwies weiß ich / nichts Weltbewegendes zu berichten … Hier, in diesen unscheinbaren, unaufgeregten lyrischen Momenten, leuchtet die Welthaftigkeit auf, die Walter Methlagl im schönen Vorwort erwähnt: wer in der zweiten Hälfte seiner Lebensreise Bilanz zieht (52 Minuten meines Lebens / sind vorüber), träumt sich nicht mehr in ferne Kontinente, sein Blick ist aufmerksam geworden fürs Nächstliegende: … noch ein Tunnel und die Gleise / verästeln sich in der Enge / des Talkessels:/ aussteigen. Wenn Roman Santelers Gedichte berühren (und sie tun es nie mit Absicht, sie sind völlig frei von jeder Attitüde), dann hier: in dieser Einfachheit, Stille und Würde.
Immer wieder gibt es zwischen den Gedichten Tagebucheintragungen, angesiedelt in einem literarischen Grenzbereich, keiner lyrischen Gattung zur Gänze zuzuordnen. Und doch hat Roman Santeler sie in seinen Gedichtband aufgenommen. Der Autor zieht alle Register des erschrockenen Schweigens, des resignierten Verstummens, aber auch der trauernden Stille, der versunkenen, wortlosen Meditation. Das scheint ihm der Maßstab zu sein, nach dem er seine Texte misst: das Ringen um Worte, um bisher Unaussprechbares Sprache werden zu lassen - nicht die formale Vollendung, nicht die poetische Raffinesse oder Originalität. Sein Anliegen ist es vielmehr, einer bedrohten Sprache auf die Sprünge zu helfen, sie aus dem allgegenwärtigen Eismeer der Stummheit hinaufzuhieven auf eine Eisscholle, das abermalige Absinken zu beschreiben, zu betrauern, die abermaligen, mehr oder minder missglückten Versuche festzuhalten, der Kälte Ausdruck zu geben.
Tagebucheintragung, 21.4.1999 (S. 31)
Dieser Pfiff geht mir
durch Mark und Bein:
Abseits!
Du stehst abseits.
Fragen nach der Gattungszugehörigkeit von Tagebucheintragungen dieser Art gehören in die erste Hälfte des Lebens. In der zweiten Lebenshälfte, wo der Blick und das Gehör schärfer werden, gilt die Aufmerksamkeit nur dem Pfiff, dem Schrecken, den er verbreitet. Fragen nach seiner Poetizität sind in diesem Kontext redundant.
Roman Santeler fängt die Sprache bei ihren Anfängen ein, da, wo sie sich aus ihren Befangenheiten schält, aus den Fesseln der Stummheit befreit; er beschreibt ihr mühevolles Lautwerden, ihr Zerbrechen, die Brocken, auch das Echo der ungesagten Dinge, und immer wieder die Unmöglichkeit des Einander-Verstehens.
Dieses Ringen um Sprache wird festgemacht an der landschaftlichen Kargheit und Herbheit des oberen Inntals. Santelers Sprache spiegelt die Schroffheit der Felsen wider, die Abgründe des finsteren Inns, die Enge der kleinen Ortschaften, die scheue Art der Menschen. Verständlich wird daher auch das Fernweh, das immer wieder durchbricht: die Hoffnung, in der fremden Sprache, ja in Esperanto, das zu finden, was in der eigenen Sprache nicht möglich scheint (Fernweh S. 45, Abschied S. 46). Und immer wiederkehrend die Trauer über das Chaos, wenn die Worte, gefangen im „Schlund“ , den erlösenden Weg in die Sprache nicht finden:
Chaos (S.49)
Mein Mund
sperrangelweit offen,
als ob tausend Worte gleichzeitig
heraus wollten
aus diesem finsteren Loch.
Das Chaos, das entsteht, wo es an Dialog mangelt, ein Mangel, der wiederum in einem gestockten Informationsfluss wurzelt, der seinerseits vermutlich wegen unaussprechbarer Emotionen erstarrt ist, dieses Chaos in die Textstruktur zu bannen, ist dem Autor meisterhaft gelungen. Auch dem Leser werden oft nur Fragmente von Informationen angeboten; am Stilmittel einer die Grenze der Verständlichkeit wiederholt unterschreitenden Knappheit erfährt der Leser die Gefahr, die von einer solch minimalistischen Sprachhaltung ausgeht; seine Hoffnung auf klärende Hinweise, hilfreiche semantische Brücken, bleibt oft unerfüllt. Immer wieder fällt, symbolisch gesprochen, die Tür vor ihm ins Schloss. Wer die Tragödie einer zermürbenden Wortarmut je selbst erfahren hat, wird diesen Gedichtband mit Erstaunen lesen; er wird sich erinnert fühlen, wird die Einbrüche ins Schweigen nachvollziehen können, wird das Ausbleiben von Antworten wiedererkennen, die latente, umfassende Dialoglosigkeit, die uns alle bedroht, spüren und sich merkwürdig getröstet fühlen.
Die zweite Hälfte des Bändchens trägt den Titel „Silentium“ und ist ganz den vielen Facetten der Stille gewidmet. Pst! (S. 55) ist eine Aufforderung, dem lauten Geschwätz Einhalt zu gebieten, das uns die Ohren verstopft; das Eigentliche ist scheu wie ein Reh, schnell wird es ein Opfer der Jäger …
In Manna (S. 59) spricht ein selbstbewusstes lyrisches Ich:
Ich
Buchstabengießer,
habe ein Feuer
entfacht
ich
Seher,
stopfe eure
sprachlosen Mäuler
ich Unbehauster,
führe euch aus dem Dunkel
ans Licht
fürchtet euch nicht.
Resignation und Verzweiflung weichen manchmal messianischem Sendungsbewusstsein.
Mit dem titelgebenden Gedicht Silentium (S. 87) schließt der Gedichtband: ein Text voller Frieden, der an Goethes Wanderers Nachtlied erinnert (Über allen Gipfeln ist Ruh …). Auch hier erfüllt den Reisenden, nun fast am Ende seines Weges, die Vorahnung von Frieden, von tiefer Stille. Die Ungewissheit des Anfangs, die Qual der Verbannung, das Leiden an der allgegenwärtigen Stummheit, die Flüchtigkeit des Glücks, das unteilbare Geheimnis der Zwiesprache mit Gott … alles wird niedersinken in eine Stille, die jedem zuteil wird. Am Ende wartet ein letzter Aspekt von Schweigen: das Aufgeben –Dürfen des Sprechens.
|