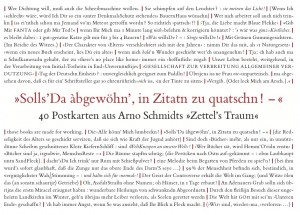Die erste Seite (5)
Freitag, 3. Dezember 2010 0:12
Weiter im Text:
(? –) : »Ganz=winzij’n Moment nur … (: dreh langsam, 1 Mal, den Kopf in die Wunder einer anderen AtmoSfäre … (?) – : nu, ne Sonne von GoldPapier, mit roth’n Bakkn et=caetera ?)) – : verfolg ma das WasserlinsnBlättchin, Franziska=ja ? – (?) – : Ganz=recht; (Ch kuck aufdii Uhr). –«; (und knien; am WegeGrabm, zu Anfang des Schauerfeld’s) : »Ch wollt die StrömungsGeschwindichkeit ma wissn : Wir habm Zeit, individuell zu sein, gelt Fränzi?« « (Und erneut zu W, /
Der erste Satz scheint an W gerichtet zu sein, wie der Schluss der zitierten Passage und der rechte Rand klar machen:
(da W Uns, anschein’d n Ausputzer
gebm wollte. (: heut regier’Ich :
morgn fahrt Ihr wieder
Diese Marginalie enthält eine wichtige zeitlich Rahmenbedingung des Geschehens, die auch gleich darauf noch einmal betont werden wird: Der Tag, den ZT beschreibt, ist in vielerlei Hinsicht ein letzter Tag, ein Tag, der in sich abgeschlossen ist und etwas besonderes darstellt. Zum heute so nicht mehr gebräuchlichen Wort „Ausputzer“ schreibt Adelung:
Der Ausputzer, des -s, plur. ut nom. sing. der etwas ausputzet. Figürlich, im gemeinen Leben, ein scharfer Verweis. Einem einen derben Ausputzer geben.
Im obigen Zitat aus der Mittelkolumne ist wohl wichtig, dass DP W gegenüber für ein und denselben Sachverhalt zwei sehr unterschiedliche Formulierungen gebraucht: Die „die Wunder einer anderen AtmoSfäre“ können auch als „ne Sonne von GoldPapier, mit roth’n Bakkn et=caetera“ beschrieben werden. Hier kündigt sich DPs Methode der Interpretation an, die später im Text als „Etym=Methode“, „Etymkunde“, „Etym=Analyse“ oder auch explizit als „Etym=Theorie“ bezeichnet werden wird. Für diese Lesart von Texten wird es – besonders auch bei denen Edgar Allan Poes – charakteristisch sein, dass eine gravitätischen Formulierung mit eine ihre Erhabenheit entlarvende Deutung gegenübergestellt wird. Ich selbst habe mir in meiner Einführung zu Schmidts erzählerischem Werk erlaubt, diese Methode als „Etymmystik“ zu bezeichnen, da zumindest DP mit dieser Methode darauf abzuheben scheint, die oberflächliche Lektüre von Texten durch eine wahrere, unmittelbarere Lektüre zu ergänzen. Ich werde hier in im weiteren dei Abkürzung EM für diese Art des Textzugriffs verwenden, wobei sich jeder nach Belieben denken mag, ob dies für Etym-Methode oder Etymmystik stehen soll.
Der zweite Teil des obigen Zitats leitet eine Messung der Strömungsgeschwindigkeit des kleinen Bächleins im „WegeGrabm, zu Anfang des Schauerfeld’s“ ein. Dies im weiteren Roman wohl keine Rolle mehr spielende Detail könnte in zweierlei Hinsicht gedeutet werden: Zum einen ist für DP die ihn umgebende Welt nicht nur Anlass zur äußerlichen Betrachtung, sondern er objektiviert sie auch – die Welt wird nicht nur betrachtet, sondern auch vermessen; auch hier liegen, wie bereits oben thematisiert, zwei Zugriffe auf die Welt nebeneinander vor. Zum anderen kann das Knien „am WegeGrabm“ auch als eine religiöse Geste gedeutet werden. Hinweis darauf könnte das kurze Poe-Zitat am linken Rand sein:
(›watered by a beautiful stream,
which bears the name of ISIS, the
divinity of the Nile & the Ceres of
the egyptians‹. (REC.WALSH))
Das Bächlein wird also assoziiert mit der Isis, der Göttin des Nils und der Ceres der Ägypter, was zum einen eine erneute Aufnahme des Themas Fruchtbarkeit ist, für das auch schon die die linke Kolumne bisher beherrschenden Jungstiere stehen können, zum anderen aber eben für das Knien „am WegeGrabm“ ein religiöses Assoziationsfeld liefert. Vor wem oder was hier dann tatsächlich das Knie gebeugt würde, lässt sich wohl noch nicht erkennen.
F stimmt der Aussage DP, man „Zeit, individuell zu sein“ schweigend zu, wie der rechte Rand verrät:
(Sie nickde, schweignd …
Weiter in der mittleren Kolumne:
(Und erneut zu W, / (Die, irgndwie=gereizt, Paul just ein’n ›Altn Dämian‹ hieß : ! –) / : »Lieb=sein Wilmi. Villeicht sind Wa, an Unserm 1 Tag Fee’rij’n, ooch noch grawitätisch! –
Meine Lektüre des Hesseschen „Demian“ liegt zulange zurück – und ich möchte sie auch nicht auffrischen –, um noch beurteilen zu können, ob es sich bei „Dämian“ um ein spezifisches Schimpfwort handelt; der Dämlack dürfte bei der Schöpfung des Wortes Pate gestanden haben.
Auch hier wird, wie oben bereits gesagt, betont, dass es sich bei dem Tag, den ZT beschreibt, um einen besonderen Tag handelt. Das Wort gravitätisch wird natürlich mit „w“ geschrieben, weil es dann gravitätischer erscheint.
: Iss’oweit Friendsel?« – ; / – ; – / : »Jetz ! –« (versetzDe der GlocknRock nebm Mir : – (präziser die Bluse von schlankstim Ausschnitt, satinisch ainzuschau’n. Der RotMund voller SchneideZähne (aber unlächlnd). /
Diese zweite Beschreibung Fs wird rechts ergänzt durch die Marginalie:
((ein ›leidliches Lärvchin‹ ? (m=m ! :
reicht nich ganz ! …[Die beiden „m“ in „m=m“ tragen im Buch einen Accent grave.]
Hier wird die spielerische Beschreibung der Kleidung Fs fortgesetzt: Die Bluse ist aus Satin und von „schlankstim Ausschnitt“ – durch das „i“ wird das Wort schlanker als in der Duden-Orthografie –, aber es ist wohl auch so, dass F an der Bluse einen Knopf zu viel offen gelassen hat, denn sie hat die satanische Absicht, DP in sich verliebt zu machen, und also kann er die Bluse auch ein wenig zu sehr hinainschauen.
Die Formulierung vom „leidlichen Lärvchen“ lässt sich zum Beispiel in Ludwig Ferdinand Hubers Lustspiel „Juliane“ wiederfinden, ohne dass ich behaupten möchte, dass dieser Text für ZT irgendeine Relevanz hat.
Ungefähr an dieser Stelle schließt der Text der erste Seite des TSs. Am Fuß der Seite findet sich eine Skizze des realen Schauerfeldes, jenes Bargfelder Grundstücks, das AS im April 1965 für 1.000 DM von Wilhelm Michels gekauft hat. Die Skizze ist mit Schrittmarken versehen, auf die im weiteren Text von ZT dann Bezug genommen wird. AS hat für viele Schauplätze seiner Texte solche Skizzen angelegt; in der ersten Buchausgabe der „Gelehrtenrepublik“ z. B. wurde seine Skizze der IRAS, der schwimmenden, stählernen Insel, auf der der zweite Teil des Romans spielt, auf den Vorsatz gedruckt.

Es hat hier einigen Aufwand gebraucht, um der ersten Seite wenigstens einigermaßen Herr zu werden – wobei, das sei hier gern noch einmal betont, keinerlei Anspruch erhoben wird, diese erste Seite tatsächlich ausgeschöpft zu haben. Es hat sich gezeigt, dass zumindest einzelne Passagen von ZT an den Leser einigen Anspruch stellen, wenn er auch nur grundlegend erfassen will, was sich im Text abspielt. Von Lesen im klassischen Sinne kann in solchen Fällen kaum mehr die Rede sein, vielmehr ist der Leser gezwungen, vieles im Text unverstanden auf sich beruhen zu lassen – nicht die schlechteste Strategie im Umgang mit ZT – oder sich den Text zu erarbeiten bzw. – das dürfte der Absicht ASs mehr entsprechen – ihn zu enträtseln.
Das AS Spaß am Verrätseln und an seiner eigenen Schlauheit gehabt hat, ist für seine treuen Leser eine Konstante des Werks. ZT geht dabei in einigen Passagen weiter als die zuvor entstandenen Texte. Gerade bei der ersten Seite wurde hier schon die Möglichkeit angedacht, dass sie eine Abwehrgeste darstellt gegenüber unbefugten Lesern, also solchen, von denen der Autor glaubt, dass sie seinem eigenen Anspruch an eine gelungene Textrezeption nicht genügen können.
[…] ich habe Ihnen da entgegen zu halten, daß es ja leider im Verhältnis zu anderen Künsten, der Musik oder der Malerei zum Beispiel, der allgemein verbreitete Irrtum beim Leser ist, weil er lesen kann, könnte er auch jedes Buch lesen, sehen Sie, in der Musik wird das niemandem einfallen, wenn ich da einem Laien eine Partitur vorlege, wird er gern zugeben, daß er nichts, auch gar nichts davon versteht, aber bei einem Buch die Buchstaben sind jedem geläufig, auch einzelne Worte, und so meint jeder, daß er ohne weiteres lesen und vielleicht gar auch schreiben könne, das ist aber ein Irrtum, denn auch in diesem Falle hat sich eben der Fachmann so weit von dem rohen Laien entfernt, daß, das gebe ich Ihnen gerne zu, eine Annäherung da schwer möglich ist, […] [BA Supl. 2, S. 10]
Diese Äußerung stammt aus einem Rundfunk-Interview, das Martin Walser bereits im Jahr 1952 mit AS geführt hat. Die hier zum Ausdruck kommende elitäre Haltung des Autors seinen potentiellen Lesern gegenüber liegt wohl ganz wesentlich auch ZT zugrunde, und das, obwohl es ironischer Weise gerade dieses Buch war, das AS so bekannt gemacht hat wie keine seiner Veröffentlichungen zuvor.
Natürlich wird meine weitere Lektüre nicht durchgehend in dieser Ausführlichkeit annotiert werden können und müssen, wie dies hier für die erste Seite geschehen ist. Es wird sich zeigen, welches Gleichgewicht zwischen Lesen und Enträtseln sich einstellen bzw. wie weit das Lesen und Enträtseln überhaupt gelingen wird.
Thema: i. Buch – Das Schauerfeld | Kommentare (13) | Autor: MF