- Das Haus
- Newsletter
- Service
- Publikationen
- Veranstaltungen
- Ausstellungen
- Buchmagazin & AutorInnen
- Bibliothek & Sammlungen
- Katalogsuche
- Museen, Festivals & Reisen
- Preise, Projekte, Archive, Tagungen, Akademien
- Literaturhäuser
- Partner



FÖRDERGEBER

PARTNER/INNEN

Ilse Aichinger. Schriftstellerin.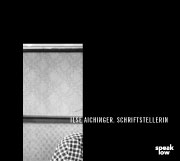 Berlin: Speak low, 2011. Zum 90. Geburtstag Ilse Aichingers ist 2011 ein akustisches Portrait der Autorin bei Speak Low erschienen. Zu hören sind Interviews und Lesungen, dazu von der Schauspielerin Corinna Kirchhoff gelesene Texte. Eine „persönliche Erinnerung“ des Verlegers Michael Krüger und Gedanken des Autors Peter Handke runden das „Portrait“ ab. Das Booklet zeigt Fotografien aus Privatbesitz, der begleitende Text erzählt von ihrer Lebensgeschichte als einer „Geschichte der Trennungen“. Tatsächlich hatte der Abschied von ihr nahestehenden Menschen besonderes Gewicht in ihrem Leben. Als ersten der neun Abschnitte der Audio CD hören wir daher vom „Ende der Kindheit“ Ilse Aichingers, das den Abschied von der Großmutter brachte, die als Jüdin von den Nationalsozialisten deportiert wurde. Das letzte „Kapitel“ heißt „Abschiedslicht“, ein Zitat der Autorin („Es liegt ein Abschiedslicht auf Allem“). Wenn Ilse Aichinger vom Ende der Kindheit, datiert mit dem 1. September 1939, erzählt, ist es vielleicht die Tiefe der Erinnerung an eine der dunkelsten Zeiten ihres Lebens, die ihr Weitersprechen zögern lässt. Die ersten vier Abschnitte des Hörbuchs gehören dieser Erinnerung an, wie sich der Nationalsozialismus in Wien breitmachte und welche Auswirkungen dieser auf ihre Familie hatte. Ihre Zwillingsschwester wurde nach England verschickt, die jüdische Mutter war zwar durch ihre halbarischen Kinder geschützt, aber die Großmutter wurde im Lager ermordet. Von wann genau das Interview stammt, ist leider unklar. Als Quellen für die Interviews wird der Bayerische Rundfunk (1981) genannt und der Österreichische Rundfunk ohne Jahreszahl. Man glaubt der Stimme anzuhören, dass Ilse Aichinger die Sechzig weit überschritten haben muss. Auf jeden Fall berührt die so unterschiedliche Ausstrahlung der Autorin über die Stimme, je nachdem wovon sie erzählt. „Die Kräfte der Kindheit hielten die Welt zusammen und die Küche der Großmutter lag mitten darin“, so schreibt Ilse Aichinger in „Kleist, Moos, Fasane“. Das Rätsel, warum die Straße, in der die Wohnung der Großmutter lag, nach Kleist benannt wurde, löst sie mit der Erklärung: „vielleicht weil nichts darin an Kleist erinnerte“. Peter Handke spricht im Abschnitt „Ein wildes kosmisches Reden“ leidenschaftlich über die „Bilder“ Aichingers, die seiner Meinung nach „aus den tiefsten Träumen kommen und vielleicht aus dem tiefsten Wachsein“. Kennt man den dritten Bezirk, so weiß man im Innersten, wie wahr es ist, wenn Ilse Aichinger schreibt: “Die Hügel fielen nieder und die Steppe begann“, auch wenn nichts davon sichtbar ist. Nach Peter Handke entsteht die Spannung aus Andeutungen von Räumen, in die es kein Vertrauen gibt, und aus dem Sieg der Bilder über das „jüdische“ Bilderverbot. Wie in Zauberformeln, mit derselben Rücksichtslosigkeit und Suggestivität beschwört sie seiner Meinung nach die Wahrhaftigkeit. Ein Wort genügt und „die Seele dessen, der liest wird nicht nur gesund, sondern auch sehend“ – so Peter Handke im Bayerischen Rundfunk 1991. Während die ersten Abschnitte also vor allem von leidvollen Erinnerungen bestimmt sind, erzählt Ilse Aichinger im Weiteren von ihrer ersten Begegnung mit „diesem Günter Eich“. Es ist tief berührend, wie die Stimme, die davor mit dem Sprechen haderte, frei wird und plötzlich ein Lachen aufleuchtet, das zu Herzen geht. Das gemeinsame Leben und Schreiben mit ihrem Ehemann Günter Eich, die gemeinsame Suche nach der Sprache machten das Glück für sie aus: „Ich war mir immer bewusst, wie viel Glück ich gehabt habe“. Die privaten Fotografien im Begleitheft schaffen neben dem literarischen Portrait der Schriftstellerin ein sehr persönliches Bild. Persönlich ist auch die Erinnerung des Verlegers Michael Krüger, der von ihrer „verhuschten“ Erscheinung spricht, und von ihrem komplizierten Interesse an Menschen, von einer „direkten Barmherzigkeit“, die er in einer Anekdote aus der Zeit Ilse Aichingers im Salzburger Land zum Besten gibt. Auch Peter Handke nimmt bei ihr etwas Witziges oder besser „Kalauerndes“ wahr und es trifft sich ausgezeichnet, dass die Schauspielerin Corinna Kirchhoff manchmal genau diesen Ton hervorzaubert. Im zentralen Abschnitt „Meine Sprache und ich“ kommt die Schriftstellerin noch einmal auf ihr Schreiben, das mitunter als schwierig und sogar hermetisch gilt, zurück. Es ist die Rede von der „Suche nach der Wirklichkeit, was ich im Schreiben versuche“ und dass das Bewusstsein ermüdet werden muss, um die Kontrolle auszuschalten „damit das Schreiben allein sein kann“ und dass „ein Hauptteil der Arbeit … das Nicht-Schreiben“ ist. Mit dieser „Erklärung“ erschließt sich der darauf folgende Text „Schlechte Wörter“ wie von selbst, denn wie Ilse Aichinger sagt: „Worte sind nicht etwas, was man behält, sondern was man hergibt.“ Beatrice Simonsen
|
| Veranstaltungen |
|
Junge LiteraturhausWerkstatt
Mo, 05.02. bis Mi, 07.02.2018, 15.00–19.00 Uhr Dreitägiger Schreibworkshop für...
Verleihung der Ăśbersetzerpreise der Stadt Wien 2016 & 2017
Do, 08.02.2018, 19.00 Uhr Preisverleihung & Lesung Der mit € 3.700 dotierte Übersetzerpreis... |
| Ausstellung |
| Tipp |
|
flugschrift Nr. 21 – MARK Z. DANIELEWSKI
Dem amerikanischen Autor Mark Z. Danielewski gelang es mit seinem Roman-Debut Das... |
|
Incentives – Austrian Literature in Translation
Neue Beiträge zu Clemens Berger, Sabine Gruber, Peter Henisch, Reinhard Kaiser-Mühlecker, Barbi... |