
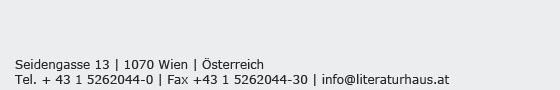



FÖRDERGEBER
PARTNER/INNEN

Laudatio von Wilhelm Genazino auf Brigitte OleschinskiAnlässlich der Verleihung des 15. Erich Fried Preises an Brigitte Oleschinski: Laudatio des Jurors Wilhelm Genazino vom 14. November 2004 Wir sind daran gewöhnt, dass beinahe wöchentlich in unseren Feuilletons wichtige Teile unserer Kultur verabschiedet werden. Immer wieder hören wir vom Ende des Romans, vom Ende der Psychoanalyse, vom Ende der Familie, vom Ende des Individuums, vom Ende der Germanistik, vom Ende der Arbeitsgesellschaft, vom Ende des Wohlfahrtsstaates. Durch die dichte Abfolge der Abschiede bleibt undeutlich, ob die Totgesagten wirklich tot sind oder nur totgeredet werden sollen, ob sie vielleicht nie gestorben waren oder gar unsterblich sind, weil sie auf wunderbar versteckte Weise weiterleben - und ob es vielleicht nur dieses elende Kulturgerede ist, das nie wirklich gelebt hat. Zu den Entschlafenen gehört seit langer Zeit auch die Lyrik. Ihre Verfasser, die Dichter, gehören (so heißt es) inzwischen einer Geheimgesellschaft an, wo sie ihre kryptischen Botschaften austauschen, die außerhalb der Geheimgesellschaften kaum noch einer hören mag und kaum noch einer versteht. Wer die Gedichte von Brigitte Oleschinski liest, vergisst dieses Gerede ganz schnell; und hat nach kurzer Zeit das Gefühl, dass Lyrik etwas ganz Wichtiges ist. Es geht von diesen Gedichten eine unangestrengte Dringlichkeit aus, ein Gestus der unspektakulären Relevanz, der Leser überrascht und sofort beeindruckt. Dabei kann man nicht sagen, dass die Eindrücklichkeit auf billige rhetorische Weise erschlichen ist. Es gibt kein Gedicht der Autorin, dem nicht die Millimeter genaue Wortarbeit anzumerken wäre, die Zurüstung des Materials, die Verkantung oder Aufweichung der Übergänge, je nachdem, die Verschränkung von Bedeutungen, kurz, die Verdichtung von Kraftzentren, ohne die kein gutes Gedicht auskommt. Dazu passt auch die Artikulation der Lyrikerin selber. Wer die Autorin einmal hat sprechen hören, ist schnell eingenommen von ihrer Eloquenz, von der ihr offenbar eingeborenen Nähe zum gedichteten Sprechen, von ihrer Bildung, genauso wie von ihrer Bereitschaft, diese Bildung wegzustoßen, um an noch nicht vorgebildete, unbegriffliche Ausdruckswelten heranzukommen. Gedichte sind Türen ins Ungewisse, sagt die Autorin. Ich lese Ihnen aus dem Band Your Passport is Not Guilty aus dem Jahr 1997 das Gedicht "Es beginnt oder endet" vor: Es beginnt oder endet mit dem Schließmuskelkuß, das Gesicht an die Schamwand zischeln und tuscheln, die Nachbarschwellen außer dem Haftmehl, auf dem die Zahnplatten Wovon ist in diesem Gedicht die Rede? Die uns geläufigen Themen kommen darin nicht vor. Vergeblich suchen wir nach deren Reflexen, also etwa nach einer Auskunft über die Lage des Subjekts, über das Vordringen politischer Gewalt, über die Klimakatastrophe, über den rabiaten Kapitalismus, über die gefährliche Selbstüberschätzung der USA, über die Staatsvertrottelung in Deutschland. Nichts von alldem gibt es in diesem Gedicht. Offenkundig handelt es sich aber auch nicht um ein Kindheitsgedicht, nicht um ein Liebesgedicht, nicht um ein Heimatgedicht, nicht um ein Landschaftsgedicht. Nach mehrmaligem Lesen hatte ich den Einfall, es thematisiert die letzten Stunden eines Totkranken in einem Krankenhaus, wurde dann aber wieder unsicher. Schwierig ist der Zugang, weil in dem Gedicht fremde, neuartige Wörter auftauchen, deren Bedeutung sich nicht einfach erschließt. Schließmuskelkuss, was mag das sein? Was könnte eine Schamwand sein? Was ist Wirrfasergarn? Und was sind Nachbarschwellen, was ist Haftmehl? Es könnte sich um eine Klebemasse handeln, die eine Zahnprothese an ein Kiefer bindet. Immerhin ist im Text von Zahnplatten die Rede. Doch dieser Hinweis hilft nicht wirklich, er bleibt äußerlich. Wir müssten schon wissen, was die anderen Worte bedeuten. Durch Zufall stieß ich auf einen Essay der Autorin und darin auf einen Satz, den ich hier anschließen will. Er lautet: "Gedichte 'handeln nicht von etwas' wie ein Roman, sie sind Stimmen, die eine andere, eine fremdere Sprache suchen für Liebe und Tod, für das Essenzielle jeden Augenblicks." Das Neuartige ihrer Anstrengung besteht darin, dass dem Text selber ein Subjekt zugesprochen wird; dieses Subjekt, obwohl es äußerlich ist und nur aus Worten besteht, die wiederum von Menschen gemacht (oder gedacht) sind, dieses Schriftsubjekt hat ein Sensorium wie ein Mensch; es hat Bewusstsein, Sprache und Gedächtnis; und es soll wahrgenommene Details und Vorgänge kognitiv verarbeiten, das heißt verknüpfen können, es soll erkennen können wie ein menschliches Bewusstsein. Brigitte Oleschinski macht Ernst mit der unter Spracharbeitern oft gehörten Klage, dass unsere Sprache nicht ausreicht, um uns, die Sprechenden, auszudrücken. Die Autorin hat eine Ahnung, woher das Gefühl der Sprachverlassenheit kommt. Es ist die Einsprachigkeit meiner Kindheit, von der sie auf ihrer Website www.neuedichte.de spricht. Diese Einsprachigkeit meiner Kindheit, von der sie "erlöst" werden möchte. Die Einsprachigkeit meiner Kindheit ist eine überaus glückliche Formulierung. Sie ist, denke ich, der Schlüssel zur poetischen Praxis der Autorin. Wie wird aus einer wirklichen oder imaginierten Erfahrung eine poetische Perspektive? Vermutlich ist Brigitte Oleschinski schon in ihrer Kindheit diese Einsprachigkeit aufgefallen, d.h. die mal wohlige, dann wieder bedrückende Monotonie des Ichs, die sich zu einem Subjektentwurf formt, der langsam zu einem Bewusstseinsschema wird, von dem wir später dann dreist behaupten, dass wir diesem Schema unserer Unverwechselbarkeit, unsere Einzigartigkeit verdanken. Dabei ahnen wir doch - ich wiederhole, wir wissen es nicht, wir ahnen es nur - dass in Wirklichkeit niemand einsprachig lebt, auch nicht ein Kind. Indem wir aufwachsen, erleben wir, dass zahllose Stimmen in unser eigenes Sprechen hineinreden, natürlich vor allem die Stimmen unserer Sozialisation, die Stimmen der Eltern und Geschwister, außerdem die Stimmen zahlloser Institutionen, Schulen und Universitäten, ferner die Stimmen der Gegenwart und Geschichte und vermutlich die diffusesten überhaupt: die Stimmen der Zeit, der unmittelbaren Gegenwart. Trotzdem behaupten wir nach wie vor die Dominanz der eigenen Stimme inmitten des Durcheinanders. Denn das eigene Bewusstsein soll es sein, dem wir die Unverwechselbarkeit unserer Identität verdanken. Dagegen behauptet Brigitte Oleschinski kühl und ungerührt: "Wir sind Einzelne nur in Geflechten. Wir denken, handeln, überleben nur in Geflechten." Aber gleichzeitig: "Wir fühlen allein, jede und jeder für sich." Ich wiederhole den Zweischritt der Reflexion: Wir denken und handeln in Geflechten, aber wir fühlen allein. Die Aufteilung bedeutet keine Entindividualisierung des Gedichts. Das Gedicht ist gleichzeitig monologisch und dialogisch. Es weist nur darauf hin, wie eminent schwierig es geworden ist, in der Nachmoderne ein Subjekt zu konstituieren, d.h. in der Flut der Töne, den eigenen Ton überhaupt noch hören zu können. Die Aufteilung, das Denken und Handeln in Geflechten, das Fühlen als einsames Individuum, hilft mir, auf die allerjüngste Entwicklung im Werk von Brigitte Oleschinski kurz einzugehen. In ihrem Band Argo Cargo, 2003 erschienen, hat die Autorin den Anfang ihres Interesses für diese neue Ausdruckswelt beschrieben. Das in der Geisterströmung auftretende Ich hat mit der verwischten, ungewissen Autorinstanz der vorigen Gedichtbände nur noch wenig gemein. Wir sehen dieses Ich jetzt auf einer poetischen Reise, auf einer Expedition in miteinander verflochtene Fremdwelten. Geisterströmung hat die Form eines buchlangen Gedichts, das durch einige Hundert Sprach- und Empfindungssplitter hindurchfließt und uns mitnimmt auf eine Zeitfahrt, in eine Erkundung der Poesie und ihrer körperlichen Kippwelten. wir reisten, (eher) wurden gereist, irgendwer zahlte das Zimmer, gab uns ein Kingsize-Bett, einen Vorhang aus Haaren und Zähnen, darin dein Rücken das flickernde Licht löschte, das Rasseln sind Milliarden und Abermilliarden, jeder führt Krieg Plötzlich, mitten im aufregenden Präsens, von dem Gedichte immer gelebt haben, sehen wir, dass die Geisterströmung genau das ist, was das Gedicht nach einer Definition des vorkantischen Ästheten Alexander Gottlieb Baumgarten seinem Wesen nach immer ist, "eine vollkommen sinnliche Rede." |
| Veranstaltungen |
|
edition exil entdeckt – Zarah Weiss blasse tage (edition exil, 2022) Ganna Gnedkova & Ana Drezga
Fr, 04.11.2022, 19.00 Uhr Neuerscheinungen Herbst 2022 mit Buchpremiere | unveröffentlichte Texte...
"Im Westen viel Neues" mit Kadisha Belfiore | Nadine Kegele | Tobias March | Amos Postner | Maya Rinderer
Mo, 07.11.2022, 19.00 Uhr Lesungen, Film & Musik Die Reihe "Im Westen viel Neues" stellt... |
| Ausstellung |
|
"Ah! THOMAS BERNHARD. Den kenn ich. – Schreibt der jetzt für Sie?"
Nicolas Mahler zeichnet Artmann, Bernhard, Jelinek, Musil & Joyce 17.09. bis 14.12.2022 Er ist der erste, der im renommierten deutschen Literaturverlag Suhrkamp... |
| Tipp |
|
OUT NOW : flugschrift Nr. 40 - Valerie Fritsch
gebt mir ein meer ohne ufer Nr. 40 der Reihe flugschrift - Literatur als Kunstform und Theorie... |
|
INCENTIVES - AUSTRIAN LITERATURE IN TRANSLATION
Buchtipps zu Kaska Bryla, Doron Rabinovici und Sabine Scholl auf Deutsch, Englisch, Französisch,... |