
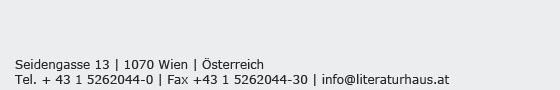



FÖRDERGEBER
PARTNER/INNEN

Laudatio auf Marcel BeyerVon Michael Krüger, dem alleinigen Juror, anlässlich der Verleihung des Erich Fried Preises 2006 am Sonntag, dem 26. November 2006, im Literaturhaus in Wien.  Brauchen wir Gedichte? Gehören sie - wie das Erzählen - zur anthropologischen Ausstattung? Gibt es, wie es die Dichter gerne hätten, ein Recht auf Poesie? Ja oder nein? Wann haben diejenigen unter uns, die nicht Dichter oder Kritiker sind und Freiexemplare erhalten, zuletzt einen Gedichtband gekauft? Und zwar nicht Mörike oder Schiller, sondern Marcel Beyer oder Norbert Hummelt oder Raphael Urweider? Das ist, ich sehe es Ihren Nasenspitzen an, schon lange her. Und trotzdem würden doch die meisten der sogenannten Gebildeten unter den Zeitgenossen selbstverständlich dafür eintreten, daß das Lesen, Memorieren oder Aufsagen von Gedichten irgendwie immer noch zu unserer Kultur gehören soll. Keiner weiß mehr so ganz genau, warum der Sohn unbedingt Trakl und die Tochter unter allen Umständen Jandl lesen soll, aber wenn sie es plötzlich nicht mehr täten, wäre es doch schade drum. Also kriegen sie zur Konfirmation den „Brunnen ewiger Dichtung“ oder das „Große deutsche Gedichtbuch“, wo sie alle drinstehen von A wie Aichinger bis Z wie Zech, von A wie „Abschied an eine Geliebte“ (Nikolaus von Bostel) bis Z wie „Zum Kampf der Wagen und Gesänge“ (Schiller), das wird dann mit guten Vorsätzen ins Regal gestellt und vielleicht sogar gelegentlich konsultiert, wenn einem die vierte Strophe vom „Abendlied“ von Matthias Claudius entfallen ist, das der Enkel so gern vorgesungen haben möchte. Es geht übrigens so:
„Wir stolze Menschenkinder Wir spinnen Luftgespinste Ach, wie recht er doch hat, der Wandsbecker Bote - wir versuchen uns in vielen Künsten und entfernen uns doch immer weiter von dem Ziel: von uns selbst. Es sieht nachgerade so aus, als multiplizierten sich die Künste, um die Distanz zu uns selbst ständig zu vergrößern. Am Anfang war „die menschliche Kultur ein Notprogramm zum Ausgleich von biologischen Ausstattungsmängeln“, wie es Hans Blumenberg formuliert hat, heute, wo alles zur Kultur geworden ist, von der Unternehmenskultur bis zur Kultur des Scheiterns, sind die im herkömmlichen Sinne kulturellen Leistungen einer Gesellschaft für diese zu großen Teilen gleichgültig geworden. Kaum einer kann noch eine Note lesen, aber man prügelt sich um Karten für die Opernpremiere und schwärmt anschließend von der sinnlichen Unmittelbarkeit der Sängerin; man steht während der Vernissage zwischen den kuriosen Objekten der modernen Kunst herum und preist laut die unvorhersehbaren Wege der Kreativität, insgeheim aber hofft man, nur ja nicht damit in tiefere Berührung kommen zu müssen - und wenn die Ehefrau unbedingt will, dann wird eben zur Künstlerförderung so ein Objekt gekauft und zu Hause über dem Sofa angebracht, damit die Gäste über die Sammelleidenschaft der Gattin staunen können - und über ihren eigenwilligen Geschmack. Da hängt es dann. Und nach vier Wochen fragt sich die Gattin, was sie eigentlich so faszinierend an den drei schwarzen Balken fand, die da so unsymmetrisch übereinandergeschraubt auf der Wand kleben. Vergessen. Schwarzes Loch. Blackout. Waren sie schön? Oder waren sie, im Gegenteil, nicht schön und deshalb faszinierend? War es die Form? Das Material? Erinnerten sie mich an etwas? Waren sie ein Zeichen für etwas anderes? Alle Begründungen weg, wie ausgeräumt das Hirn. Kein Mensch fühlt sich verpflichtet, nach solchen Erfahrungen mit der Kunst sein Leben zu ändern, und als einzige Hoffnung bleibt, der Künstler, der die drei Balken über dem Sofa angebracht hat, möge im Preis steigen, damit sich wenigstens die Investition gelohnt hat. So wie der Mensch vom Ursprung her ein Allesfresser ist, so hat er diese Eigenschaft nach der Periode des Mangels und der Entbehrung symbolisch auf die Kultur übertragen: Man darf getrost darüber staunen, was der sogenannte Kulturbeflissene in einer Woche in sich hinein fressen kann, ohne daß sich irgendeine Wirkung zeigen würde. Auch den blitzhaften Erleuchtungen der Poesie, wenn dieser Ausdruck erlaubt ist, geht es nicht viel anders. Zwar sind die Gedichte noch da, aber wir haben vergessen warum. Keiner (außer den Dichtern) will sie freiwillig lesen, man läßt sie sich allenfalls vorlesen, open air oder mit Musik, auf Festivals oder als CD im Auto - Astern, schwälende Tage, / alte Beschwörung, Bann, / die Götter halten die Waage / eine zögernde Stunde an -, da fährt es sich doch gleich besser, und die Zumutungen an den Verstand, den diese Verse nun einmal bilden, verflüchtigen sich im Sound. Gedichte sind eine Zugabe geworden. Nach dem Verschwinden des Theatertextes in die reine Leiblichkeit der Aufführung, des Körperspiels, und dem Rückzug des lyrischen Sprechens, der Poesie, in eine seltsam schattenhafte Scheinbedeutung, hat in unseren kulturbeschwerten, kulturgesättigten Gesellschaften allein der Roman als matter Abglanz der Großen Erzählung unserer Existenz seinen sicheren Platz halten können, wenn auch meistens auf unterster ästhetischer Wahrnehmungsgrenze, als Trivialroman, der immer wieder und ohne jede Hemmung die alten Geschichten - eben weil sie alt sind - hervorkramt und neu arrangiert. Ausgerechnet der Lebenszeitfresser par excellence hat den anderen Künsten den Rang abgelaufen! Ausgerechnet die Kompensationsdroge Roman soll am Ende der Zivilisation besser geeignet sein, unsere spielerischen Ansprüche zu befriedigen? Theater und Poesie dagegen, die am Anfang der Kultur standen und das Schwere der Existenz im Spiel mit dem Mythos aufzuheben trachteten, sind durch die Veralltäglichung und Banalisierung der kulturellen Vorstellungen und Praktiken an den äußersten Rand des gegenwärtig waltenden gesellschaftlichen Interesses gedrängt worden. Brauchen wir trotzdem Gedichte? Ihren Rhythmus? Ihr Spiel mit Worten und Bedeutungen? Ihre Dichte? Ihre Integrationsfähigkeit? In letzter Zeit sind drei bedeutende deutschsprachige Dichter gestorben, die auf sehr unterschiedliche Weise ihren Glauben an die Verwandlung durch Poesie gelebt haben: Thomas Kling, Robert Gernhardt und zuletzt Oskar Pastior. Alle drei waren auf geradezu besessene Weise davon überzeugt, daß die großen Metamorphosen, die nach dem Ende der Metaphysik unser Schicksal nicht mehr zu bestimmen vermögen, uns jedoch noch immer daran erinnern, daß wir eines haben, nur noch in der Dichtung zu entwerfen und nachzuspielen sind. Alle drei waren große Spieler im Schiller'schen Sinne. Alle drei hatten die Geschichte der Poesie als Geschichte der gesamten Gattung im Kopf: Denn nur in der Poesie, in keiner anderen Kunstform, sind das Murmeln und der Schrei, der Seufzer und die pathetische Überschreitung, die frenetische Freude und die abgrundtiefe Trauer immer noch gegenwärtig. Sappho und Kling waren, trotz der zeitlichen Trennung, Geschwister. Und alle drei waren sich darüber im klaren, daß Dichtung nichts mehr mit Natürlichkeit zu tun hat, sondern eine sehr bestimmte Form von Künstlichkeit darstellt. Sieht man von Robert Gernhardt ab, der spät, aber gottlob nicht zu spät für seine Reime geliebt wurde, hatte die Arbeit der Dichter außerhalb der eingeweihten Zirkel kaum Resonanz gefunden. Erst ihr Tod hat sie, Gott weiß für wie lange, berühmt gemacht, was immer das heißen mag. Erst die durch ihre plötzliche Abwesenheit entstandene Leerstelle hat ihre poetische Leistung ins rechte Licht gerückt. Waren sie zu Lebzeiten als sonderbare Einzelgänger bekannt, die in ihren alchimistischen Wortküchen aus einem X ein U destillieren konnten, wurden sie nach ihrem Tod, wenigstens für den einen blitzhaften Moment, in ihrer einzigartigen Bedeutung erkannt. Aus diesen Gründen - und um all das Gesagte und sattsam Bekannte noch einmal zusammenzufassen - aus diesen Gründen sind neben allen anderen Förderungen Preise für Dichter so außerordentlich wichtig. Nicht nur wegen des Geldes, das sie selbstverständlich sehr gut gebrauchen können, weil das Honorar von Gedichtbüchern selten mehr als zwei Monatsmieten deckt, sondern weil Preisverleihungen die äußerst seltene Gelegenheit bieten, dem Erkenntnisspiel der Dichter Achtung und Dankbarkeit entgegenzubringen. Denn wenn ein Dichter heutzutage die „verkörperte Unwahrscheinlichkeit“ darstellt, dann erinnert er uns daran, was uns auf unserem Weg verlorengegangen ist. Kein Dichter erwartet natürlich mehr, daß man auf seinen Rat hört, kein Dichter glaubt mehr wirklich daran, daß man seine Arbeit achtet und ehrt, kein Dichter spielt noch mit der Vorstellung, daß es nicht nur einen Präsidenten der Republik, sondern auch einen macht-, aber nicht einflußlosen Dichter der Republik geben müsse, ein alle paar Jahre wechselndes Amt, das übrigens in England und Amerika noch ausgeübt wird. Der Dichter, der einst ein Seher war, dem die Götter die Zunge lösten, muß sich heute durch Selbstinspiration in Stimmung bringen, wenn er seiner schwierigen Arbeit nachgeht, die dann, wenn er Glück hat, in gebundener Form tausend Leser findet. Aber wenigstens Preise sollen die Dichter erhalten, damit sie laut gepriesen werden können. Nun habe ich also die große Ehre, den Erich-Fried-Preis vergeben zu dürfen. Als ich gefragt wurde, ob ich dazu bereit sei, habe ich sofort zugesagt. Fast zwanzig Jahre war ich mit Erich Fried befreundet, den ich 1963 in London kennenlernte. Ich erinnere mich ziemlich gut an den ersten Besuch in seinem Haus, an die mit Papier überladene Küche und an den unerwarteten Besuch eines Nachbarn, den man damals noch ungestraft als Neger bezeichnete, eines ziemlich hochrangigen Diplomaten aus Westafrika von nebenan, dem das Salz ausgegangen war, der aber stundenlang in Frieds Küche blieb und schließlich von seiner salzlosen hungrigen Familie abgeholt werden sollte, die aber ebenfalls blieb, so daß plötzlich zwischen den gefährlich schwankenden Bücher- und Papierbergen eine ziemlich große und schwarz-weiß zusammengewürfelte Familie mit immer neu eintreffenden weiteren Mitgliedern versammelt war und ich mich besorgt zu fragen begann, wann und wie dieser Dichter je zum Schreiben kommen würde. Eine müßige Besorgnis, wie sich später herausstellen sollte, denn Erich hatte die unerhört seltene Gabe, überall und noch im größten Chaos schreiben zu können. Die reifste Leistung in dieser Hinsicht war sein emsiges Kritzeln in meinem entsetzlich lauten Deux cheveaux zur letzten Tagung der Gruppe 47. Während wir froh waren, das wacklige Auto vor dem Tagungsort der Pulvermühle endlich verlassen zu dürfen, blieb Erich Fried, der die ganze Fahrt von München an einem neuen Gedicht-Zyklus geschrieben hatte, bis zur Vollendung seiner Verse sitzen. Dieser generöse Mensch hätte den Weltuntergang verpaßt, den er um alles in der Welt vermeiden wollte. Er hat viel geschrieben, manche sagen: zu viel. Aber Gerechtigkeit und Liebe, diese zwei Götter, denen er zu jener Zeit huldigte, gaben ihm viel auf. Er war ständig unterwegs, mit Stock, unergründlicher Aktentasche und Plastiktüten voller Material, das ihm wohlmeinende und meistens weniger generöse Menschen als er einer war zugesteckt hatten. Ein geradezu chinesischer Wanderdichter, wie es nach ihm keinen mehr gab. Wer also sollte den Preis kriegen, den ich im Namen von Erich Fried vergeben durfte? Die Antwort stand sofort fest, sie sitzt materialisiert unter Ihnen: Marcel Beyer. Er gehört zu der Handvoll jüngerer Dichter - jünger als ich, um genau zu sein, - die mich mit jedem neuen Text - egal ob Gedicht oder Roman oder Essay - überraschen. Auf die Frage, was ein Gedicht auszeichnen müsse, um sie zu interessieren, sagte die amerikanische Dichterin Elizabeth Bishop: Es muß mich überraschen. Die meisten Dichter tun dies nicht, und das soll gar nicht abwertend klingen. In der Regel sind die überraschungslosen Dichter erfolgreicher als alle anderen, versierter und eingängiger. Sie haben ein paar solide formale Tricks, ein paar sprachliche Zauberkunststücke drauf, mit denen sie geschickt operieren, aber man spürt nach den ersten zehn Texten nicht mehr die Dringlichkeit, die Notwendigkeit. Und es gibt auf der anderen Seite Dichter, die einen nicht loslassen. Oft sind es ihre dunklen Gedichte, die einen länger verfolgen, weil man ihnen auf die Sprünge kommen will, die Wendungen haben, die man auf Anhieb nicht versteht, oder mit einem Vokabular arbeiten, das einem nicht vertraut ist und das man sich erst er-lesen muß. Um solche Gedichte abzuwerten oder sich ihrer zu erwehren, nennt man sie gerne hermetisch. In Deutschland ist dies ein Verdachtswort, in Italien dagegen eine hohe Auszeichnung, die auf Ungaretti, Montale und Luzi angewandt wurde: auf eine Literatur, auf eine Poesie, die auf hochkonzentrierte Weise die genaue Beobachtung und die Reflexion im begriffszersetzenden Medium der poetischen Sprache zum Ausdruck bringt. Nicht viel anders geht auch Marcel Beyer in seinem mir ans Herz gewachsenen Band „Erdkunde“ vor. Aber er sieht eben anders und anderes als Ungaretti, Montale, Celan, Jandl oder Kling. Sein Gebiet für die poetische Feldforschung liegt zur Zeit im Osten, im Osten Deutschlands und in den östlichen Ländern Europas, in Polen, in Rußland. Das ist, nach all den kostenlosen Ausflügen nach Rom, in die Provence oder durch die gleichmacherischen Schluchten von New York ein Novum: Die Westbindung, von der wir politisch und philosophisch profitiert haben, ist in diesen Texten nicht das allein selig machende Weltverhältnis. Marcel Beyer kennt die Städte östlich von Dresden, der Stadt, in der der 1965 in Württemberg geborene Dichter heute lebt; er kennt aber auch die sprachlichen Ausdrucksformen der ganz anders sozialisierten Mentalitäten, das spießige, kleinbürgerliche Milieu, das sich noch nicht anpassen konnte - wollte? - an den westlichen Standard; und er verwendet in seinen Texten die Worte und Bilder, die diesem Milieu und dieser Mentalität angemessen sind: Es geht, wie es in „Erdkunde“ heißt, um seine „Ossifizierung“ in jener „Ackermanngegend“, wo „alles pappig und grau“ ist. Der Bachelard'schen Phänomenologie der Ecken, Winkel und Verstecke fügt er den Kohlenkeller hinzu und das ausgehobene Grab. Und es hat nichts mit sozialromantischer Sentimentalität, sondern mit genauer Beobachtung zu tun, wenn in diesen Gedichten von Keuchhusten, Nesselfieber, feuchten Kammern, von Wand- und Dielenfäule, Kellerluft, Kohlenstaub, Feuchtigkeit in den Mauern, von Kondensmilch und Pfirsich aus der Dose, Rollmops und eingelegten Erbsen die Rede ist; hier wird eben nicht von Pinien am Mittelmeer, von Gladiolen und Rosen in südlichen Gärten geschwärmt, wenn der Blick von den Menschen mit Existenzrisiko weg auf die Natur fällt, sondern er sieht Schafgarbe, Löwenzahn, Wundklee, Wolfsblume und wilden Rhabarber, eben das, was dort wächst. Marcel Beyers Gedichte sind alles andere als analytisch-essayistisch oder gar touristisch, sie integrieren das Fremde nicht in gefälligen Reimen, um es erträglich, genießbar zu machen, sondern lassen es in seiner Fremdheit schroff bestehen. Ich glaube, wir haben aus instinktiver Furcht vor unliebsamen Entdeckungen noch gar nicht begonnen, uns mit der Realität dieses Ostens auch nur in Grenzen bekannt zu machen - oder wir ahnen bestenfalls, wenn wir Stasiuk, Odija oder etwa den jungen ukrainischen Dichter Serhij Zhadan lesen, daß sich an und hinter den Grenzen eine bedrohliche, weil andere, fremde Realität aufbaut, die mit unseren vergleichsweise harmlosen Problemen nichts oder nur wenig zu tun hat. Der muß man sich, will man sie begreifen, aussetzen, damit man sie eben nicht gleich auf den - meistens falschen - Begriff bringt. In diesem Sinne sind die Gedichte aus der „Erdkunde“ kleine, hochaktive Speicher für nicht auf den Begriff zu bringendes Sprachmaterial, das der Dichter Marcel Beyer auf seinen Expeditionen gesammelt hat. Er ist in einem ganz un-modischen Sinn ein Ethnologe, ein teilnehmender Beobachter, ein Horcher und Merker, der nicht verleugnen kann, daß die ganz und gar subjektive Wahrnehmung der Poesie die einzig wahrhafte Aufschreibungsmethode in diesem unsicheren Grenzgebiet ist. Nur die instinktive Beeindruckung durch den Gegenstand der Beobachtung kann zu etwas Objektivem führen. Und da Marcel Beyer offenbar auch etwas von Musik versteht, sind seine Gedichte Sprach-Kompositionen. „Die Schrift im geläufigen Sinn ist toter Buchstabe, sie trägt den Tod in sich. Sie benimmt dem Leben den Atem“, heißt es in einer Rousseau-Replik bei Derrida. In Gedichten, wie sie in Marcel Beyers „Erdkunde“ stehen, ist das Gegenteil der Fall - sie bringen diese andere Welt ans Licht und zum Klingen, wenn auch der Klang manchmal dunkel ist. Diese andere Welt erhält in den Gedichten von Marcel Beyer eine Anschaulichkeit und Plastizität, die ein vollständiges Gegenbild entwickelt zu der ideologisch stabilisierten Realität, wie wir sie aus der Zeitung erfahren, wenn von Ostdeutschland oder dem „Osten“ die Rede ist. Wie der Dichter in seiner „Erdkunde“ verschiedene ineinander verschlungene Motivketten, wie er Vergangenes und Gegenwärtiges ineinander blendet, wie er Reime und Binnenreime einsetzt, um das Tempo zu drosseln oder die Aufmerksamkeit zu steigern, wie er Traum und Tagtraum zu einem metaphorischen Rätsel verknüpft, das sich erfolgreich der kritischen Auflösung widersetzt - und wie er bei all dieser Kunstleistung als Dichter und Arrangeur seines Sprachmaterials hörbar bleibt und an Kontur und Physiognomie gewinnt - das alles macht diesen Band zu einem Ereignis. Denn wer nur die Form beherrscht, verfällt in einen stumpfen Historismus, der uns kalt läßt; auch die Form muß Gegenstand der Bearbeitung werden. Brauchen wir Gedichte? Hatten wir eingangs gefragt. Ja, natürlich, solche wie sie in „Erdkunde“ stehen, lautet die kurze Antwort. Herzlichen Glückwunsch zum Erich-Fried-Preis. |
| Veranstaltungen |
|
edition exil entdeckt – Zarah Weiss blasse tage (edition exil, 2022) Ganna Gnedkova & Ana Drezga
Fr, 04.11.2022, 19.00 Uhr Neuerscheinungen Herbst 2022 mit Buchpremiere | unveröffentlichte Texte...
"Im Westen viel Neues" mit Kadisha Belfiore | Nadine Kegele | Tobias March | Amos Postner | Maya Rinderer
Mo, 07.11.2022, 19.00 Uhr Lesungen, Film & Musik Die Reihe "Im Westen viel Neues" stellt... |
| Ausstellung |
|
"Ah! THOMAS BERNHARD. Den kenn ich. – Schreibt der jetzt für Sie?"
Nicolas Mahler zeichnet Artmann, Bernhard, Jelinek, Musil & Joyce 17.09. bis 14.12.2022 Er ist der erste, der im renommierten deutschen Literaturverlag Suhrkamp... |
| Tipp |
|
OUT NOW : flugschrift Nr. 40 - Valerie Fritsch
gebt mir ein meer ohne ufer Nr. 40 der Reihe flugschrift - Literatur als Kunstform und Theorie... |
|
INCENTIVES - AUSTRIAN LITERATURE IN TRANSLATION
Buchtipps zu Kaska Bryla, Doron Rabinovici und Sabine Scholl auf Deutsch, Englisch, Französisch,... |