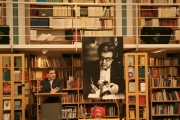- Das Haus
- Newsletter
- Service
- Publikationen
- Veranstaltungen
- Livestream
- Livestream-Archiv
- Ausstellungen
- Buchmagazin & AutorInnen
- Incentives
- Bibliothek & Sammlungen
- Katalogsuche
- Partnerinstitutionen
- Erich Fried Gesellschaft
- Programme
- Internationales Literaturfestival Erich Fried Tage 2015
- Erich Fried Preis 2014
- Friederike Mayröcker Symposium 2014
- Internationales Literaturfestival: Welt - wohin? 2013
- Erich Fried Preis 2012
- SHORT CUTS. Erich Fried Tage 2011 - RĂĽckschau
- Erich Fried Preis 2010 in Bildern
- Erich Fried Tage 2009
- Erich Fried Preis 2008
- Erich Fried Tage 2007
- Erich Fried Preis 2006
- Erich Fried Tage 2005
- Chronik
- Mitglieder
- Preis
- Publikationen
- Erich Fried Bibliographie
- Links zu Erich Fried
- Erich Fried Lectures
- Programme
- Joseph Roth Gesellschaft
- Alexander Sacher Masoch Stiftung
- Stiftung "Holfeld-Tunzer-Preis"
- Erich Fried Gesellschaft





FÖRDERGEBER
PARTNER/INNEN

Erich Fried Preis 2006 Der Erich Fried-Preis wird auf Vorschlag einer jährlich wechselnden, autonom entscheidenden Jurorin oder eines ebensolchen Jurors vergeben. Dieser Modus ist dem Verfahren nachgebildet, das bei der Vergabe des renommiertesten deutschen Literaturpreises vor 1933, des Kleist-Preises, angewendet wurde und das seit der Neuerrichtung des Preises 1985 wieder angewendet wird.
|
| Veranstaltungen |
|
edition exil entdeckt – Zarah Weiss blasse tage (edition exil, 2022) Ganna Gnedkova & Ana Drezga
Fr, 04.11.2022, 19.00 Uhr Neuerscheinungen Herbst 2022 mit Buchpremiere | unveröffentlichte Texte...
"Im Westen viel Neues" mit Kadisha Belfiore | Nadine Kegele | Tobias March | Amos Postner | Maya Rinderer
Mo, 07.11.2022, 19.00 Uhr Lesungen, Film & Musik Die Reihe "Im Westen viel Neues" stellt... |
| Ausstellung |
|
"Ah! THOMAS BERNHARD. Den kenn ich. – Schreibt der jetzt für Sie?"
Nicolas Mahler zeichnet Artmann, Bernhard, Jelinek, Musil & Joyce 17.09. bis 14.12.2022 Er ist der erste, der im renommierten deutschen Literaturverlag Suhrkamp... |
| Tipp |
|
OUT NOW : flugschrift Nr. 40 - Valerie Fritsch
gebt mir ein meer ohne ufer Nr. 40 der Reihe flugschrift - Literatur als Kunstform und Theorie... |
|
INCENTIVES - AUSTRIAN LITERATURE IN TRANSLATION
Buchtipps zu Kaska Bryla, Doron Rabinovici und Sabine Scholl auf Deutsch, Englisch, Französisch,... |