- Das Haus
- Newsletter
- Service
- Publikationen
- Veranstaltungen
- NEU Livestream
- Livestream-Archiv
- Ausstellungen
- Buchmagazin & AutorInnen
- AutorInnen
- AUFTRITTE
- Rezensionen Buch
- Rezensionen 2019
- Rezensionen 2018
- Rezensionen 2017
- Rezensionen 2016
- Rezensionen 2015
- Rezensionen 2014
- Rezensionen 2013
- Pressespiegel 2000-2010
- AutorInnen A
- AutorInnen B
- AutorInnen C
- AutorInnen D
- Autorinnen E
- AutorInnen F
- AutorInnen G
- AutorInnen H
- AutorInnen I
- AutorInnen J
- AutorInnen K
- AutorInnen L
- AutorInnen M
- AutorInnen N
- AutorInnen O
- AutorInnen P
- AutorInnen Q
- AutorInnen R
- AutorInnen S
- AutorInnen T
- AutorInnen U
- AutorInnen V
- AutorInnen W
- AutorInnen Z
- Rezensionen Sachbuch
- Verlage
- Dank an Verlage
- Impressum
- Incentives
- Bibliothek & Sammlungen
- Katalogsuche
- Partnerinstitutionen

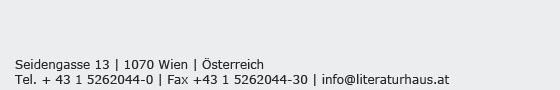



FÖRDERGEBER
PARTNER/INNEN

Cluadia Bitter: Die Welt auf meiner Haut.Leseprobe
Ich greife zur Flasche Wein und fülle mein Glas voll, hastig trinke ich es in einem Zug und stelle es mit Schwung wieder auf den Tisch. Nein, ich setze mich nicht mehr an den Tisch, ich bleibe stehen, sage ich. Oder besser noch, ich gehe herum. Seht, wie ich gehen kann, Schritt für Schritt. Ich gehe um den Tisch herum, mit einem bitteren Lächeln im Gesicht, es ist ein bitterer Geschmack in meinem Mund, er kommt nicht vom Wein. Ich gehe zur Musikanlage und schalte sie ein, Klaviermusik ertönt, ich drehe den Lautsprecherregler nach oben, jetzt kann ich nicht mehr hören, dass der Mann sich beschwert, dass ihn etwas stört am Essen, am Tisch, an mir. Ich kann nicht mehr hören, dass die Enkel sich zanken, weil sie sitzen bleiben müssen, bis alle fertig gegessen haben. Ich kann nicht mehr hören, worüber die Söhne mit der Tochter reden. Ich kann nicht mehr hören, dass verlangt wird, dass die Musik abgestellt wird, dass man sich ja kaum unterhalten könne. Ich lausche den einzelnen Tönen des Klaviers, ich stelle mir vor, dass dieses Klavier hier neben dem Tisch stünde und ich selbst meine Finger sachte auf die schwarz-weißen Tasten drücken würde, dass meine dünnen Hände diese Töne erzeugen würden. Ich betrachte meine dünnen Hände, streiche die Finger entlang, spüre die Töne in meinen Fingerspitzen und höre nicht mehr, was an dem Tisch vor sich geht, ob die Familienmitglieder streiten oder lachen, ob sie schimpfen oder weinen, ob sie da sind oder nicht. Ich schenke mir Wein nach, niemand außer mir trinkt Wein, niemand hat sich ein Bier aus dem Kühlschrank geholt, niemand hat das Essen angerührt. Es ist doch jeden Sonntag dasselbe, denke ich. Ich behalte den Schluck Wein im Mund, gurgle ihn, um den bitteren Geschmack loszuwerden. Vielleicht war das Gemüse zu weich gekocht, vielleicht war das Fleisch zu lange gebraten, vielleicht war der Wein zu kalt, das Bier zu warm. Vielleicht lag es an den Farbunterschieden der zwei Tischplatten, vielleicht an den ausgeblichenen Stoffsets, vielleicht am Essig in der Marinade, vielleicht an den Figuren auf dem Kinderbesteck, vielleicht am schneeweißen Haar meiner Großmutter, vielleicht aber auch an den Stühlen aus dem Möbelhaus. Ich schalte die Anlage wieder aus und gehe zum Tisch zurück, setze mich auf meinen Stuhl und sage, ihr könnt jetzt gehen, ich hoffe, es hat euch geschmeckt, wäre schön, wenn ihr nächsten Sonntag wieder kommt, ich werde mich bemühen, vergesst nichts, lasst nichts liegen, vergesst mich nicht. Kommt gut heim, passt gut auf euch auf. Ich öffne ihnen die Tür, ich mache sie weit auf, warte, bis alle ihre Mäntel und Jacken angezogen haben und der Reihe nach wieder aus der Wohnung hinausgehen. Bis nächsten Sonntag, ich freue mich schon, rufe ich ihnen noch nach, bevor ich die Türe schließe und doppelt verriegle. Ich lehne mich an die Wohnungstür und seufze tief, jetzt ist es vorbei, wie schön es doch war, dass sie alle da waren, die ganze Familie, dass sie alle geredet haben und gelacht, einander in die Augen gesehen haben. Ich gehe zum Tisch und blase die Kerzen aus, ich nehme den großen Topf und gehe damit zum Klo, schütte den ganzen Inhalt hinein und muss dreimal hinunterspülen, bis alle Karotten-, Paprika- und Kohlrabistückchen verschwunden sind. Dann betrachte ich den Boden des Kochtopfes und bin erleichtert, dass keine Spuren eines Anbrennens zu bemerken sind. Ich stelle ihn in die Spüle. Dann leere ich die drei Salatschüsseln ins Klo. Das Fleisch aus der Pfanne gebe ich in den Mülleimer unter der Spüle. Ich räume die Teller und das Besteck wieder auf. Hätte heute einen meiner Söhne bitten können, dass er die Bestecklade repariert, denke ich. Wieder habe ich es vergessen. Nächsten Sonntag, nehme ich mir vor. (S. 88 ff)
|
| Veranstaltungen |
|
Sehr geehrte Veranstaltungsbesucher
/innen! Wir wünschen Ihnen einen schönen und erholsamen Sommer und freuen uns, wenn wir Sie im September... |
| Ausstellung |
| Tipp |
|
OUT NOW: flugschrift Nr. 35 von Bettina Landl
Die aktuelle flugschrift Nr. 35 konstruiert : beschreibt : reflektiert : entdeckt den Raum [der... |
|
INCENTIVES - AUSTRIAN LITERATURE IN TRANSLATION
Neue Buchtipps zu Ljuba Arnautovic, Eva Schörkhuber und Daniel Wisser auf Deutsch, Englisch,... |