- Das Haus
- Newsletter
- Service
- Publikationen
- Veranstaltungen
- NEU Livestream
- Ausstellungen
- Buchmagazin & AutorInnen
- AutorInnen
- AUFTRITTE
- Rezensionen Buch
- Rezensionen 2019
- Rezensionen 2018
- Rezensionen 2017
- Rezensionen 2016
- Rezensionen 2015
- Rezensionen 2014
- Rezensionen 2013
- Pressespiegel 2000-2010
- AutorInnen A
- AutorInnen B
- AutorInnen C
- AutorInnen D
- Autorinnen E
- AutorInnen F
- AutorInnen G
- AutorInnen H
- AutorInnen I
- AutorInnen J
- AutorInnen K
- AutorInnen L
- AutorInnen M
- AutorInnen N
- AutorInnen O
- AutorInnen P
- AutorInnen Q
- AutorInnen R
- AutorInnen S
- AutorInnen T
- AutorInnen U
- AutorInnen V
- AutorInnen W
- AutorInnen Z
- Incentives
- Rezensionen Sachbuch
- Verlage
- Dank an Verlage
- Impressum
- Bibliothek & Sammlungen
- Katalogsuche
- Partnerinstitutionen





FÖRDERGEBER
PARTNER/INNEN

Erwin Einzinger: Ein kirgisischer Western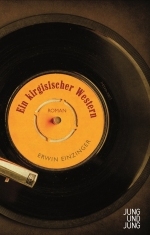 Roman. Man kommt herum als LeserIn des neuen Romans von Erwin Einzinger: Vom Nördlichen Eismeer ins südliche Chile, vom Kärntner Gurktal über die Beskiden bis nach Iowa. Zeile für Zeile eröffnet sich eine Welt zwischen Orten und Gegenden, auf deren Besuch keine illustrierten Reiseführer in Bahnhofsbuchhandlungen vorbereiten. Unter den zahlreichen poetologischen Reflexionen, die vom Erzähler gerade wie von ausgewählten Figuren – etwa einem literaturaffinen ehemaligen Baupolier – angestellt werden, nimmt sich eine Passage durch überraschende Programmatik und den Erweis einer literaturgeschichtlichen Reverenz aus: „Einmal mehr versucht nun dieses Buch, das nicht zuletzt aus der Wunschvorstellung heraus entstanden sein mag, mit Geduld Material aus ganz unterschiedlichen Sphären zu verarbeiten und einzubinden, den Raum auch für Zwischenbemerkungen zu öffnen. Und in diesem Sinne darf wieder in Erinnerung gerufen werden, was Paul Eluard in einem Interview in La Gazette des Lettres vom 2. Februar 1946 erklärt hat: Poesie, die sich bestimmten Themen versage, sei eine minderwertige Poesie.“ (242) Das Buch gibt über sich selbst Auskunft: Wovon es nach seinen eigenen poetologischen Prämissen handelt, ist potenziell alles. Und auch die Sprache des Romans lässt sich in Alliterationen und Assonanzen, in Wortspielen und kleinen Manierismen hören, was gut gelaunten Ohren Freude bereitet und nie gesucht wirkt: Sei dies der Auftritt des „ein wenig wund wirkenden Weitwandersmann[es]“ (121), das verlängerte Wochenende mit „Schlemmen in Schallemmersdorf“ (370) oder „ein junger Reiher“, der – genau! – „[u]nten am Weiher“ (229) steht. Die erzählerische Organisation des Ganzen folgt durchaus nicht jenen genrespezifischen Mustern, die der Romantitel nahelegen könnte. Die erzählte Welt ist jedenfalls nicht die eng begrenzte eines genrehaften Western, der in Kirgisistan situiert wäre. Im Gegenteil, so unbeschwert weltläufig hüpft selten ein Text von Kontinent zu Kontinent. Schon nach den ersten paar Seiten stellen sich mindestens zwei Fragen: Wovon wird hier eigentlich erzählt? und: Wie passt das alles zusammen? In insgesamt 51 Kapiteln, die selbst wiederum in kürzere Abschnitte unterteilt sind, begegnet man einer Vielzahl von Figuren, manchen flüchtig, quasi im Vorbeigehen, anderen wiederholt und wieder andere begleitet man länger, so etwa die beiden polnischen Studenten der Metallurgie Tadeusz und Leszek auf ihrer Rucksacktour durch Norwegen. Von manchen Orten, etwa einem Erholungsheim für abgebrannte Komponisten, ist öfters die Rede; der hügelige Westen Großbritanniens hingegen wird in einem Nebensatz gerade einmal erwähnt. Präsentiert wird all das in einem Modus fragmentarischen Erzählens vieler kurzer Geschichten und Eindrücke. Es werden Anekdoten zum Besten gegeben, kunsthistorische Exkurse folgen auf Lokalhistörchen. Man erfährt in genealogischen Ausführungen manches über Vorfahren und Vorzeiten, während wie zufällig Verwandtschaften und Bekanntschaften zwischen Figuren aufblitzen, die noch kurz zuvor scheinbar nichts miteinander zu tun hatten. Dazwischen, davor und danach stößt man auf reichlich Detailwissen aus Geschichtsbüchern, aus dem Fernsehen und vom textintern stilisierten Hörensagen. Schon im ersten Satz erfahren wir, was wir bislang womöglich nicht gewusst haben: „Vor neuntausend Jahren wuchs die erste Gerste.“ (7) Manchmal hingegen weiß auch die Erzählinstanz nicht weiter, begnügt sich mit Anspielungen oder ergeht sich in ausgiebigen und nicht selten amüsanten Umschreibungen, statt Namen und Daten zu nennen. Ein Motiv, das den Roman durchzieht, ist das Zurücklegen weiter Wegstrecken zu Fuß. Die einschlägigen Fußgänger treten als „moderne[...] Pilgersleute“ oder „agnostische[...] Weitwanderer“ (275) auf. Als rätselhafte Hauptfigur ist der langjährige Lebensgefährte einer Sopranistin auszumachen, der von starken Hautausschlägen malträtiert „zunächst zurückgezogen in einer ostdeutschen Stadt gelebt, dann sein Geld als Mitorganisator von Goldwaschkursen in der Schweiz verdient hatte, bevor er auf die verrückte Idee verfallen war, seinen Job aufzugeben, um zu einer abenteuerlichen Weitwanderung Richtung China aufzubrechen, die sich über mehrere Jahre hinziehen sollte.“ (459) Ganz unvermutet taucht dieser Wandersmann mit seinen Insignien – Rucksack und Rindslederhut – im Text wiederholt auf, beispielsweise auf einem Friedhof, wo er mit Hochprozentigem aus seinem Flachmann die Blumen auf dem Grab eines polnischen Dichters gießt. Genaueres über seine Weitwanderunternehmung und ihre Planung lässt sich nur vermuten. Jedenfalls steht sie in Zusammenhang mit Schriftstücken und Aufzeichnungen des Wanderers, die ein venezianischer Sammler und Antiquar namens Signore Elli säuberlich vermappt aufbewahrt. Diese reichen bis in die Jugendjahre des späteren Wandersmanns zurück, in denen er eine literarische „Idee zu einer Folge von in loser Form aufeinander bezogenen Berichten und Impressionen [hatte], die er zu einem privaten Notizbuch eines Herumtreibers und Weltenwanderers stilisieren wollte.“ (466) Wie hängen nun diese verstreuten Aufzeichnungen, die Weitwanderunternehmung, das erwähnte Buch mit dem Titel Ein kirgisischer Western und all das andere, die zahlreichen Figuren, die disparaten Geschehnisse, die verstreuten Orte, die sich zwischen den zwei Buchdeckeln finden, miteinander zusammen? Hin und wieder zeichnen sich während der Lektüre unverhoffte Verbindungen ab, manchmal erkennt man unversehens außergewöhnliche Verwandtschaften, stößt auf die mögliche Ursache eines Ereignisses; ja gar die Vermutung, dass die Aufzeichnungen des Weitwanderers, von denen des Öfteren die Rede ist, vielleicht im Romantext selbst zu finden sein könnten, liegt zeitweise nahe. Eines aber ist sicher: Erwin Einzingers Schreibweise, seine „Schule der Aufmerksamkeit“, wie es Leopold Federmair genannt hat, seine Kunst des Auswählens und Arrangierens bringt eine Textwelt hervor, die durchwegs Freude macht. Und gerne lässt man sich vom Erzähler adressieren, wird Teil des gemeinschaftlichen Wir, das angeboten wird, auf einer Reise durch einen Roman, in dem allerhand zu sehen und zu hören, also zu lesen ist. Thomas Assinger Originalbeitrag |
| Veranstaltungen |
|
Junge LiteraturhausWerkstatt - online
Mi, 13.01.2021, 18.00–20.00 Uhr online-Schreibwerkstatt für 14- bis 20-Jährige Du schreibst und...
Grenzenlos? (Literaturedition Niederösterreich, 2020) - online
Do, 14.01.2021, 19.00 Uhr Buchpräsentation mit Lesungen Die Veranstaltung kann über den Live... |
| Ausstellung |
|
Claudia Bitter – Die Sprache der Dinge
14.09.2020 bis 25.02.2021 Seit rund 15 Jahren ist die Autorin Claudia Bitter auch bildnerisch... |
| Tipp |
|
LITERATUR FINDET STATT
Eigentlich hätte der jährlich erscheinende Katalog "DIE LITERATUR der österreichischen Kunst-,... |
|
OUT NOW flugschrift Nr. 33 von GERHARD RĂśHM
Die neue Ausgabe der flugschrift des in Wien geborenen Schriftstellers, Komponisten und bildenden... |