- Das Haus
- Newsletter
- Service
- Publikationen
- Veranstaltungen
- NEU Livestream
- Ausstellungen
- Buchmagazin & AutorInnen
- AutorInnen
- AUFTRITTE
- Rezensionen Buch
- Rezensionen 2019
- Rezensionen 2018
- Rezensionen 2017
- Rezensionen 2016
- Rezensionen 2015
- Rezensionen 2014
- Rezensionen 2013
- Pressespiegel 2000-2010
- AutorInnen A
- AutorInnen B
- AutorInnen C
- AutorInnen D
- Autorinnen E
- AutorInnen F
- AutorInnen G
- AutorInnen H
- AutorInnen I
- AutorInnen J
- AutorInnen K
- AutorInnen L
- AutorInnen M
- AutorInnen N
- AutorInnen O
- AutorInnen P
- AutorInnen Q
- AutorInnen R
- AutorInnen S
- AutorInnen T
- AutorInnen U
- AutorInnen V
- AutorInnen W
- AutorInnen Z
- Incentives
- Rezensionen Sachbuch
- Verlage
- Dank an Verlage
- Impressum
- Bibliothek & Sammlungen
- Katalogsuche
- Partnerinstitutionen

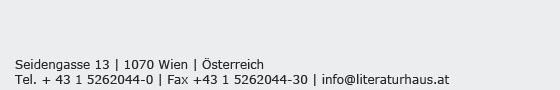



FÖRDERGEBER
PARTNER/INNEN

Leseprobe: Soma Morgenstern - "Der Tod ist ein Flop"Die offene Tür Aladar Csanda, der Schriftsteller, saß vor seinem Schreibtisch und blickte zum Fenster hinaus. Von der Höhe des zwanzigsten Stocks sah er den Tumult auf der schnurgeraden Avenue: das ungeschlachte Schwanken und Schweben der überladenen Lastwagen, das hurtige Gleiten der so farbenfrohen New Yorker Taxis, den spasmatisch bald einsetzenden, bald aussetzenden Doppelstrom der Fußgänger. Er sah das ganze Getriebe der geschäftigen Avenue ungeheuer nah mit den Augen; mit den Ohren aber hörte er es bloß als ein fernes eintöniges Brausen, kaum deutlicher denn das Rauschen des Nachtwinds, nicht stark genug, den Schlaf zu scheuchen, nicht sanft und monoton genug, die Gedanken einzulullen. Auf den Dächern der kaum mehr als achtstöckigen Häuser unten in den Seitenstraßen lag noch graublau der Dunst des frühen Morgens und täuschte den Beobachter hoch oben vor dem Schreibtisch eine Stille und Einsamkeit vor, wie man sie nur auf dem Gipfel eines hohen Bergs genießen oder auf der Höhe eines Wolkenkratzers in New York sich einbilden kann, wenn man namentlich tagaus tagein in dem Zwang fortlebt, inmitten des Getriebes dieser rastlosen Stadt auf der taubstummen Erhabenheit eines Hochhauses sich denkfrisch und schreibfähig zu erhalten. Das war ihm seit Jahren gelungen, ging es ihm durch den Sinn, und er lächelte zufrieden, als wäre es nur ihm persönlich geglückt, das gewaltige Monster zu überlisten. (S. 9) © 1999, zu Klampen, Lüneburg.
|
| Veranstaltungen |
|
Junge LiteraturhausWerkstatt - online
Mi, 13.01.2021, 18.00–20.00 Uhr online-Schreibwerkstatt für 14- bis 20-Jährige Du schreibst und...
Grenzenlos? (Literaturedition Niederösterreich, 2020) - online
Do, 14.01.2021, 19.00 Uhr Buchpräsentation mit Lesungen Die Veranstaltung kann über den Live... |
| Ausstellung |
|
Claudia Bitter – Die Sprache der Dinge
14.09.2020 bis 25.02.2021 Seit rund 15 Jahren ist die Autorin Claudia Bitter auch bildnerisch... |
| Tipp |
|
LITERATUR FINDET STATT
Eigentlich hätte der jährlich erscheinende Katalog "DIE LITERATUR der österreichischen Kunst-,... |
|
OUT NOW flugschrift Nr. 33 von GERHARD RĂśHM
Die neue Ausgabe der flugschrift des in Wien geborenen Schriftstellers, Komponisten und bildenden... |