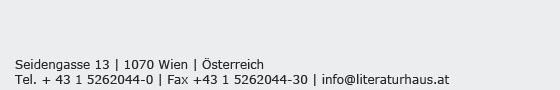Das Vogelhaus
Der Wind wehte stark, durch die Fenster war sein lautes Pfeifen zu hören. Draußen auf der Terrasse klopfte die große Sonnenblume an die Glasscheibe. Ich war noch nicht lange wach. Ich hatte einen unruhigen Traum gehabt, ich musste viel in Bewegung gewesen sein, als ich aufwachte, hatte ich eine Wunde am Handrücken.
Es war eine Stunde vor Mittag, es war ein Feiertag, wir waren bei Lauras Eltern zum Essen eingeladen. Sie wohnen zehn Häuser entfernt, in derselben Straße am Fluss; das ist nicht unbedingt ein Vorteil, sie kommen viel zu oft auf Besuch. Ich zog mich an und ging hinunter ins Wohnzimmer. Laura war noch im Pyjama. Sie saß mit einer Tasse Tee vor dem Fernseher. Ihre Beine waren in eine Decke gewickelt, neben ihr auf dem Sofa lehnten die Krücken. Sie blickte zu mir nach hinten, als sie mich hörte, und mit einem mürrischen Augenrollen hinunter auf meine Pantoffeln. Ich dachte, dass sie vielleicht eingenickt war und das Geräusch der Pantoffeln sie geweckt hatte.
»Morgen«, sagte ich.
»Morgen«, sagte sie.
Ich fragte, wie lang sie schon wach sei. Ihre Antwort war ein selbstmitleidiges Nicken, das mir zu verstehen geben sollte, dass sie wieder nicht habe durchschlafen können.
»Hast du etwas geträumt?« fragte sie.
»Sieht ganz danach aus.«
Ich hielt ihr meinen zerkratzten HandrĂĽcken entgegen. Am Ansatz des rechten Zeigefingers waren zwei dĂĽnne Risse zu sehen, mit dunkelroter Kruste an den Enden.
»Aha«, sagte sie.
Ich ging in die KĂĽche und setzte Kaffeewasser auf. Es war offensichtlich, dass mein Traum sie nicht interessierte, sie wollte mir nur andeuten, auf diese Weise, dass es meine Schuld sei, zumindest indirekt, dass sie eine schlaflose Nacht gehabt hatte.
»Hast du das nicht gestern schon gehabt?« rief sie mir nach. »Hast du nicht gesagt, du hättest dich an der Werkbank geschnitten?«
»Nein«, sagte ich.
Während das Wasser kochte, ordnete ich den Zeitungsständer. Ich sortierte die alten Magazine aus und warf sie weg. Als ich fertig war, ging ich hinauf ins Badezimmer. Ich putzte die Zähne und wusch mir das Gesicht. Wieder im Erdgeschoss, schenkte ich Kaffee ein und setzte mich an den Tisch. Ich konnte den Fernseher sehen. Der Ton war leise geschaltet, es war fast nichts zu hören, nur ein Summen, ich nahm an, dass sie mich nicht hatte wecken wollen, und jetzt war sie wohl zu faul, um nach der Fernbedienung zu greifen. Sie lag anderthalb Meter entfernt auf dem Tisch. Unter gewissen Umständen, so viel war klar, mochte das schon zuviel sein.
Auf dem Sender, den sie eingeschaltet hatte, einem Musikkanal, lief eine Dokumentation. Ein berühmter Popstar führte durch seine Villa. Sein Anwesen umfasste mehrere tausend Quadratmeter. Die Kamera verfolgte ihn durch fünf Schlafzimmer und sechs Bäder, im Garten ein Swimmingpool mit Sprungbrett und Brunnen, eine Sitzbank befand sich auf der einen Seite unter Wasser, auf der anderen war ein großer Bildschirm montiert. Es musste irgendwo im Süden gedreht worden sein, keine Spur von Wind, von Regen gar nicht zu sprechen.
Ich trank den Kaffee und rauchte. Ich ĂĽberlegte, ob ich hinunter in die Werkstatt gehen sollte. Ich hatte das BedĂĽrfnis, etwas zu arbeiten. Ich wusste nicht, ob es Laura gegen-
über unhöflich wäre, ich konnte es nicht entscheiden. Einen Moment lang dachte ich, dass ich sie fragen könnte, sozusagen um ihre Erlaubnis, aber was für einen Unterschied hätte das gemacht? Ich setzte mich an den Schreibtisch, auf der anderen Seite des Wohnzimmers, und schaltete den Computer ein. Es war noch eine Stunde Zeit. Auf einmal seufzte Laura laut auf und schlug sich mit der flachen Hand auf den Gipsfuß.
»Ist das zu glauben?« rief sie. »Manche scheinen wirklich nicht mehr zu wissen, wohin mit ihrem Geld. Sollen sie es doch gleich den Schweinen zum Fraß vorwerfen!«
Ich blickte zum Fernseher, auf der Suche nach dem Auslöser ihres Anfalls. Der Popstar stand in seiner Garage. Sechs Autos standen darin, darunter ein Porsche und zwei Limousinen. Ich hatte nichts dazu zu sagen. Ich wollte ihr nicht den Gefallen tun und ihr zustimmen. Abgesehen davon war es egal. Von mir aus hätte er zwanzig Autos besitzen können.
Ich schaltete den Computer aus und ging hinunter in die Werkstatt. Sie musste wissen, dass sie bei mir an der falschen Adresse war, sie kannte mich, ich war nicht wie ihre Mutter, sie musste das wissen. Ich sagte kein Wort. Ich war der Meinung, sie wĂĽrde verstehen, ich hatte ein deutliches Zeichen gesetzt.
Ich schlüpfte in die Arbeitshose und ging an die Werkbank. Das Dach des Vogelhauses musste noch angeschraubt werden. Es ist ein mittelgroßes Haus, ich schätze, dass es genug Platz bieten wird für drei oder vier Vögel, Amseln oder Meisen. Ich holte den Akkuschrauber und fing an zu arbeiten, vier Schrauben, das musste genügen. Es war keine Villa, es diente seinem Zweck. Als das Dach fertig war, machte ich mich auf die Suche nach Schleifpapier. Ich fand keins, ich ging hinüber ins andere Zimmer und suchte dort. Ich wusste nicht, wo ich es hingetan hatte. Es gibt so viele Schränke und Kästen, viel zu viele, ich fragte mich, wer auf die Idee gekommen war, all diese Schränke zu kaufen. Oben konnte ich Laura herumgehen hören. Die Krücken klapperten laut auf dem Steinboden. Ich blieb stehen und lauschte. Es dauerte nicht lang, dann öffnete sie die Kellertür und rief nach mir:
»Wir sollten dann gehen.«
Ich antwortete nicht. Sie konnte nicht wissen, wo ich war, ich hatte mich nicht mehr bewegt, nachdem die Tür geöffnet worden war. Sie sollte glauben, dass ich in der Werkstatt war, hinter der Brandschutztür.
»Hörst du mich?« rief sie. »Es ist kurz vor zwölf, meine Mutter hat schon angerufen.«
Sie wartete auf eine Antwort.
»Warum hast du das Telefon nicht mitgenommen? Wir haben ausgemacht, dass du das Telefon mitnimmst, wenn du nach unten gehst.«
Ich musste ein bisschen lachen, ich hatte das Telefon vergessen. Sie stand oben mit dem GipsfuĂź und konnte nicht herunter. Ich blickte auf die Uhr. Sie gab bald auf und warf die KellertĂĽr zu.
Ich fand das Schleifpapier und arbeitete weiter an meinem Haus. Ich konnte sie schon sehen, die Vögel, wie sie sich in ihrem bescheidenen Wohnzimmer tummelten, sie haben nichts außer ihren existenziellen Bedürfnissen, sie fressen und trinken, hin und wieder, in geregelten Abständen, sorgen sie dafür, dass sie nicht aussterben.
Ich hatte nicht vorgehabt, noch lange zu arbeiten. Ich wollte bald hinauf gehen und mich zum Fortgehen bereit machen. Ich fand, dass genügend Zeit verstrichen war, sie hatte ihre Strafe bekommen, und ich nahm das Vogelhaus und trug es hinüber in den Lagerraum, als ich von oben Lauras Stimme hörte. Sie humpelte wild mit den Krücken und rief etwas, ich konnte nichts verstehen, die Tür zum Kellerabgang war noch geschlossen, es war sehr laut, die Schritte stampften vor Wut, und dann wurde die Kellertür aufgestoßen und sie fiel die Treppe herunter.
Ich hörte ihre Stimme, einen erstickten Schrei, dann das Aufschlagen ihres Körpers auf den Stufen. Ich lief hinüber zur Treppe. Sie lag mit dem Kopf in meine Richtung und hatte die Augen geöffnet, ihr Blick zeigte eine seltsame Leere, kein Schrecken oder Entsetzen, und mein erster Gedanke war, dass sie tot war. Sie war es nicht, aber sie konnte nur ihre Augen bewegen. Ich rief einen Krankenwagen, das war das Ende. Sie sitzt heute im Rollstuhl, in unserem früheren Haus, ich bin in die Stadt gezogen, in eine Wohnung. Ich wollte nicht, dass man glaubt, ich hätte sie verlassen, weil sie im Rollstuhl sitzt. Vielleicht hätte ich es getan, wer weiß, wenn sie mir nicht zuvorgekommen wäre. Sie hatte kein Wort mehr mit mir gesprochen. Ich hatte sie im Krankenhaus besucht, ich war jeden Tag dort gewesen, an ihrem Bett, viele Stunden lang, sie hatte auf keine meiner Fragen geantwortet. Sie gab mir die Schuld an dem Unfall. Sie sagte es nicht, sie brauchte es nicht zu sagen, es gab nichts mehr zu sagen, auch davor hatte es nichts zu sagen gegeben.
© Bernhard Strobel Nichts, nichts. Erzählungen © Literaturverlag Droschl Graz - Wien 2010