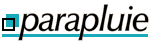
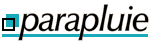 |
elektronische zeitschrift für kulturen · künste · literaturen |
|
no. 25: Übertragungen
|
Übertragungsverluste und ReibungswärmeDöblins Berlin Alexanderplatz auf der Bühne |
||
von Birte Lipinski |
|
Vielleicht langweilen sie sich mit ihren Schiller- und Hebbeldramen. Vielleicht vertrauen sie der Gegenwartsdramatik nicht oder glauben an die Publikumswirksamkeit der Titel. Die Feuilletons stellen unterschiedliche Spekulationen darüber an, warum die Theater in Deutschland immer mehr Romane für die Bühne adaptieren. Sicher ist: Die Romandramatisierung ist kein neues Phänomen, aber zurzeit besonders beliebt. Gerade Fassungen sogenannter 'kanonischer' Romane mit hohem Bekanntheitsgrad im bildungsbürgerlichen Publikum haben einen zentralen Platz auf den Spielplänen. Sie nehmen Übertragungsverluste in Kauf und gewinnen -- was? |
||||
An den Theatern wird heute Thomas Manns Zauberberg ebenso aufgeführt wie seine Buddenbrooks, Fontanes Effi Briest steht neben Goethes Werther besonders hoch im Kurs. Die Romane Dostojewskis und Dickens' werden ebenso dramatisiert wie die Texte E.T.A. Hoffmanns. Dramatisierungen sind aus der gegenwärtigen Praxis der Theater nicht wegzudenken. |
||||
Dramaturgen und Regisseure nehmen es dabei auch mit komplex gebauten, wenig linearen und sprachlich experimentellen Werken auf, wie die Dramatisierung von Döblins Berlin Alexanderplatz durch Frank Castorf zeigt. Die Uraufführung der Bühnenfassung fand 2001 am Schauspielhaus Zürich statt. Eine passendere Umgebung scheint der Ort der Wiederaufnahme zu bieten: 2005 wurde das Stück von der Volksbühne Berlin in einer überarbeiteten Fassung in der Reichstagsruine aufgeführt. Dabei erklärt Döblin zur Premiere der Alexanderplatz-Verfilmung in einem Interview in der Lichtbild-Bühne (Nr. 240, 7.10.1931), |
||||
"daß ein Theaterstück sich nicht aus Alexanderplatz formen ließ. Denn die Schicksalslinie Biberkopfs, besser gesagt, die Schicksalsmelodie war nicht in die Bühnenform zu pressen. In die Bühnenform, deren Form vorschreibt -- Aufteilung in Szenen und Aktschlüsse und in einem Schluß, eiserner Vorhang herunter -- das ging nicht. Es konnte nur ein Rundfunk-Hörspiel oder ein Film werden." |
||||
Das scheint besonders interessant, propagiert doch gerade Döblin epische Formen im Theater, eine Neubelebung des Konzepts 'Roman-Drama'. Damit stellt er sich auf die Seite Brechts mit seiner Forderung nach einem epischen Theater. |
||||
Wenn er hier nun so skeptisch gegen die Möglichkeit einer dramatischen Bearbeitung seines Romans ist, so steckt hinter der Äußerung sicher auch ein bestimmtes (historisches) Gattungsverständnis. Als traditionelles Drama nach Gustav Freytags Pyramidenschema ist Berlin Alexanderplatz, ein Roman mit stark episodischer Struktur und montierten Texten, in der Tat nicht vorstellbar, ebensowenig als Inszenierung auf der Guckkastenbühne mit Vorhang zur Akteinteilung. |
||||
Nur nicht so förmlich: Neue Dramatik und die Romandramatisierung | ||||
Die Vorstellungen vom Drama haben sich über die aktuelle Dramatik und das Regietheater derart verändert, daß ein Begriff wie das 'dramatische Erzählen' nicht mehr als Widerspruch in sich gesehen wird. Modernes Theater setzt, mit Brechts epischem Theater als Vorbild, Erzähler ein, macht die Figuren zu Erzählern ihrer eigenen Geschichte, montiert und collagiert und arbeitet stark mit Medien und Medienwechseln. Nicht zuletzt hat es sich vom traditionellen Dramenbau mit Akt- und Szeneneinteilungen und einem spezifischen Spannungsbogen getrennt. Diese neuen Formen in Dramatik und Inszenierung kommen der Romandramatisierung sicher entgegen. |
||||
Frank Castorf setzt sich immer wieder mit Romanen als Vorlage für seine Inszenierungen auseinander. Er erklärt in einem Interview in Theater der Zeit (9/2001) in Bezug auf die Dramatisierung von Dostojewskis Die Dämonen sein Interesse an Romanstoffen wie folgt: |
||||
"[Herkömmliches Theater ist] meistens ungeheuer pappig, das hat schon Bertolt Brecht gestört. Mir ist eine gewisse Komplexität, eine Komplexität, wie sie in einer vielschichtigen Wahrnehmungsweise, aber auch stofflich in den Romanen Dostojewskis liegt, ganz wichtig. [... Die] Komplexität der Weltwiderspiegelung, der möchte ich mich gerne annähern, dieser Ungleichzeitigkeit. Das finde ich wichtig als ästhetisches Prinzip. Daher arbeite ich auch meist mit Romanen. Theaterstücke sind oft ein Generalplan: Die suggerieren eine Erkennbarkeit und Beherrschbarkeit der Welt." |
||||
Castorf sieht sich damit in der Tradition einer linksorientierten Gesellschaftskritik. Die Form der Romandramatisierung bekommt in seinen programmatischen Äußerungen auch einen gesellschaftskritischen und politischen Duktus, wenn er erklärt, der Neoliberalismus glaube genau wie das traditionelle Drama an die Beherrschbarkeit der Welt. Es scheint, die Romandramatisierung entspräche besonders den politischen und politisch erzieherischen Implikationen, die Brecht mit seinen Forderungen ans Theater entwickelte. |
||||
Zu beachten ist hier, daß eine Textsorte, mithin eine mehr oder weniger vorgegebene Form, zuallererst für sich steht, und es erst die Inhalte bzw. deren Ausgestaltungen sind, die eine politische Richtung vorgeben können. Gilt dies für die Romandramatisierung gegenteilig? Eher nicht. Bedenkt man, daß auch Hermann Löns' Der Wehrwolf dramatisiert wurde und mit welch 'völkischem' Impetus zur Zeit des nationalsozialistischen Regimes mittelalterliche Epen auf die Bühne gebracht wurden, so wird klar, daß die Dramatisierung epischer Texte an sich keine politische und/oder ideologische Richtung vorgibt. Eindeutigkeit bis hin zur Schwarz-weiß-Malerei kann auch über Romandramatisierungen vermittelt werden. Castorfs Auswahl der Romanvorlagen dürfte hier weit entscheidender sein. Auch den Wunsch nach hoher Komplexität in der Darstellung von Welt und deren Uneindeutigkeit erfüllt wohl weniger die Textsorte Romandramatisierung als vielmehr die vom Regisseur und Autor getroffene Textauswahl. Den Wunsch nach Komplexität und Uneindeutigkeit in der Weltdarstellung erfüllen Dramatisierungen vor allem dann, wenn sie mit der Differenz zur Romanvorlage spielen. Dann allerdings kann das Spiel mit unterschiedlichen Bedeutungen zum Äquivalent für die erzählerische Mehrdeutigkeit im epischen Text werden. |
||||
Döblins Berlin Alexanderplatz ist zum Verfolgen dieser Ziele eine passende Wahl. Die Geschichte des aus der Haft entlassenen Franz Biberkopf wird in zahlreichen Episoden geschildert. Das große Personal und die vielfältigen Arten von Rede, die unautorisierten und in den Text collagierten Auszüge aus Nachrichten, Liedern, Flugzetteln, Werbung und Gesprächsfetzen zeigen die Heterogenität der Welt und ihrer Wahrnehmung in besonderem Maße. |
||||
Auch nach Auflösung klarer inhaltlicher und struktureller Vorgaben für das Drama bleibt die Romandramatisierung eine diffizile Übertragungsleistung, eine Transposition, die auf einen medialen Wechsel ausgelegt ist. Der zum stillen Lesen bestimmte Text wird umgearbeitet für die Bühne und deshalb der neuen Funktion angepaßt. Als obligatorische Veränderung muß aus dem fortlaufenden Romantext bei der Dramatisierung ein Text erstellt werden, der sich in Dialog und Nebentexte teilt. Die Bühne muß auf die Erzählerstimme verzichten oder sie den Figuren oder einer Off-Stimme zuordnen. Sie muß mit Orts- und Zeitbestimmungen der Vorlage umgehen. Der neue Dramentext bildet ein Übergangsstadium in ein anderes Medium und nimmt dessen Konventionen in versprachlichter Form auf. Er kann Licht- und Tonanweisungen, Hinweise zum Spiel mit dem Publikum oder den Räumlichkeiten enthalten. Bestimmte inhaltliche Elemente sind im Theater nur schwer darstellbar. Massenszenen, Brände, phantastische Gestalten müssen über die Technik produziert, weggelassen oder umgeformt werden. Zudem ergibt sich das Problem der Darstellbarkeit von Gedanken, Träumen, theoretischen Reflexionen oder ironischen Erzählerkommentaren. Das Personal der Handlung muß in den meisten Fällen verkleinert, Nebenhandlungen müssen gekürzt oder ausgelassen werden, um die Romanhandlung als Stück überhaupt spielbar zu machen. 'Übertragungsverluste' sind bei der Dramatisierung also die Regel. Castorf erklärt das im bereits oben zitierten Interview zur notwendigen Erfahrung bei der Annäherung an einen Roman: "Wenn ich einen Stoff habe wie die Dämonen, da kommt mir vor, daß man immer nur Grenzwerte der Annäherung schafft." |
||||
In keinem Fall wird die Dramatisierung dem Roman entsprechen, das machen schon der Gattungswechsel und der neue Kontext unmöglich. Ob die Veränderungen durch den Gattungswechsel obligatorisch oder fakultativ sind, ist in vielen Fällen nicht klar unterscheidbar, denn die durch den Gattungswechsel bedingten Veränderungen müssen immer auch semantische Veränderungen in sich tragen. |
||||
Und neues Leben blüht aus den Ruinen | ||||
Um seine Schwerpunkte zu setzen und das ihm Wichtige herauszuarbeiten, gibt Castorf als Methode an, die Romane in ihre Einzelteile zu zerlegen, um dann die interessantesten Bestandteile neu zusammenzustellen. |
||||
"Da kann man natürlich sagen, daß da eine Zertrümmerung stattfindet. Und da unterscheiden sich die Betrachtungsweisen, manche sehen nur Zerstörung, und manche sehen, wie aus den Trümmern etwas Neues entsteht." |
||||
Im Fall der Alexanderplatz-Dramatisierung entsteht etwas, das auf den ersten Blick zusammenhängender und eindeutiger wirkt als Döblins Roman. Der Text ist wesentlich stärker auf die Person Franz Biberkopf und dessen direktes Umfeld konzentriert, die Handlung ist in sich stärker gebunden, viele Handlungsstränge und Figuren wurden gestrichen. Die Szenen gehen oft direkt ineinander über, wobei sich Castorfs Szenenfolge nur lose an der Kapiteleinteilung des Romans orientiert. |
||||
Zur größeren Geschlossenheit trägt in der Inszenierung außerdem das Bühnenbild bei, das vier Wohncontainer, einer davon als Kneipe eingerichtet, und eine größere Spielfläche davor anbietet. Die Zahl der Orte ist damit ganz wesentlich verringert. Alle Kneipenszenen spielen in derselben Kneipe, die Wohnungen der Hauptfiguren liegen Tür an Tür. Daraus ergeben sich interessante Möglichkeiten parallelen Spiels. Die Container werden benutzt, als befänden sie sich in direkter Nachbarschaft: Wer aus dem Fenster sieht, wird gesehen; die Figuren wechseln die Wohnungen, denn die Container sind miteinander verbunden. Auch dies trägt zur größeren inneren Bindung der Handlung bei. Beim Szenenwechsel wird oft nur der Beobachtungsschwerpunkt des Rezipienten verlagert. Das wiederum eröffnet gleichzeitig interessante Möglichkeiten zu parallelen Handlungen. Diese sind zum Teil durch die Containerfenster sichtbar, manchmal nur hörbar. Was in den Containern geschieht, wird per Tonabnahme nach draußen getragen, in einigen Szenen gibt es hörbare Parallelhandlungen in einem der Container, die irritieren und nicht immer einfach zuzuordnen sind. Castorf erklärt dazu: "Ich finde das ganz spannend, wenn man eben nicht alles sieht, was man sehen möchte im Theater." Ein gewisser Voyeurismus, zumindest aber Neugier, wird erzeugt -- aber nicht immer befriedigt. Auf diese Weise wird die gewünschte Komplexität dann doch darstellbar, denn Parallelhandlungen können alternative Wahrnehmungswelten und indirekte Kommentare zur Haupthandlung anbieten. |
||||
Berlin segodnja -- Berlin danas -- Berlin dzisiaj -- Berlin today | ||||
Inhaltlich fällt vor allem die Aktualisierung des Geschehens auf. Die Handlung in Döblins Roman beginnt im Jahr 1928 und endet im Januar 1929. Döblin arbeitet genaue Daten in den Text ein und gibt ihm damit den Anschein von Authentizität und Aktualität; der Text wurde zeitnah veröffentlicht, war ein Zeitroman und wohl auf Wiedererkennung angelegt. |
||||
Castorf setzt Biberkopfs Erlebnisse in das Berlin um die Jahrtausendwende. Mehr als das: Das Stück wird per Regieanweisung tagesaktuell gehalten, wenn Franz Biberkopfs Verwundung jeweils auf den Aufführungsabend datiert wird: |
||||
CILLY |
||||
Diese Veränderungen erhalten den Zeitstück-Charakter von Berlin Alexanderplatz auch in der Neufassung. Einem historisierenden Blick, wie er heute auf Döblins Roman sowohl aus Perspektive der Leserschaft wie aus der der Literaturwissenschaft geworfen werden muß, setzt Castorf mit seiner Aktualisierung wiederum eine Darstellung von Gegenwart entgegen. Damit stellt sich ein Paradoxon ein: Die Veränderung auf inhaltlicher Ebene macht es möglich, als zentralen Gegenstand das gesellschaftliche und kulturelle Leben im Moment der Rezeption des Kunstwerks zu wahren. Die Entfernung vom Text Döblins bringt eine Annäherung an dessen Ziele mit sich. Die Aktualisierung eines Zeitromans stellt in dieser Hinsicht auch einen Begriff wie den der 'Werktreue' implizit in Frage. |
||||
Castorf setzt das Geschehen in die Gegenwart und verändert es so, daß sich die Handlungsmotivation an heutige Verhältnisse anpaßt. Auch Zitate heutiger Kultur und Lebensweise der sozial schwachen Schichten und einer großstädtischen Subkultur fließen ein: die Wohnungen werden zu Wohncontainern, ständig läuft der Fernseher und es wird mit der Handkamera gefilmt, statt jüdischen Händlern trifft Biberkopf Verkäufer auf einem "Polenmarkt", auf dem T-Shirts mit dem Aufdruck I feel good aus Hongkong und Taiwan sowie Hosenträger verkauft werden. Überfälle werden mit Mickey-Mouse-Masken auf dem Gesicht begangen und musikalisch vom Soundtrack von Lost Highway untermalt. Ebenfalls der Gegenwart entnommen ist die Musik der Gruppe Rammstein, auch die Lieder der Rio-Reiser-Band Ton Steine Scherben, zum Beispiel Mein Name ist Mensch, haben, wenngleich älter, durchaus einen Platz in der (Jugend-) Kultur um das Jahr 2000, sicher aber zur Zeit der Adoleszenz des Protagonisten. |
||||
Vorgänge, die aus heutiger Sicht nur noch schwer verständlich sind, werden durch eine Neuanlage der Figuren teilweise aufgefangen: Daß Franz und Reinhold Frauen untereinander 'weitergeben', wenn sie für sie selbst nicht mehr interessant sind, wird als Motiv zwar beibehalten, aber insofern verändert, als daß die betroffenen Frauen Russinnen oder Kroatinnen sind, die aus Angst vor Abschiebung bei Reinhold und Franz bleiben. Die Abhängigkeit und Hörigkeit der Frauen (in Döblins Roman der Arbeitslosigkeit geschuldet, teils aber auch eine Art von umgekehrtem 'Bratkartoffelverhältnis') wird in der aktualisierten Fassung durch die Migration erklärbar. Cilly tröstet Trude: |
||||
CILLY |
||||
Absage an die Menschlichkeit | ||||
Die Passage, in der Franz von Reinhold aus dem fahrenden Auto geworfen wird und dabei einen Arm verliert, zeigt besonders, wie die Handlungsmotivation von Figuren verändert werden und so ein Geschehen komplett umgewertet werden kann. Der Roman schildert hier eine Verfolgungsjagd: Pums Bande wird beim Einbruch ertappt und muß fliehen. Franz, der sich von Pums betrogen fühlt, empfindet das als gerechte Strafe und lacht über den Vorfall. Dies bringt Reinhold in Rage -- gleichzeitig fällt ihm ein, daß es Franz gewesen sein könnte, "der ihm die Weiber abtreibt". Hier gibt es also eine tatsächliche Motivation für den grausamen Vorfall. |
||||
Ganz anders gestaltet sich der Vorgang in der Dramatisierung: Man sieht das Auto durch eine Bretterwand auf die Bühne brechen, es stoppt kurz, die Hintertür geht auf, Franz wird aus dem Wagen geworfen, das Auto rast zur Musik von Wild at Heart weiter. Dann hält es an und fährt langsam und vorsichtig zurück. Der Bandenchef und Reinhold steigen aus, stehen vor dem verwundeten Franz: |
||||
PUMS |
||||
Schon daß Reinhold keine wirkliche Motivation mehr hat, Franz aus dem Wagen zu werfen, sondern dies einfach aus 'objektlosem Haß' tut, Franz also nur ein Zufallsopfer ist, zeigt, daß Reinhold noch unberechenbarer angelegt ist als im Roman. Zudem hält er es nicht für nötig, sich zu erklären. Die vorgebrachte Begründung wirkt kalt und ironisch in Bezug auf das Leiden Biberkopfs. Alle Beteiligten stehen ungerührt um den am Boden liegenden Franz herum, diskutieren, ob man ihn umbringen sollte, und zeigen auf diese Weise eine Kälte und Gleichgültigkeit, die der Roman in dieser Härte nicht ausdrückt. Man verläßt den Ort des Geschehens, ohne Franz zu helfen -- aber auch, ohne ihn zu töten. Und so wird klar, daß man ihm keinerlei Bedeutung zumißt. Pums und seine Bande haben keine Angst, von ihrem Opfer verraten zu werden. Insofern ist es nur konsequent, daß der folgende Teil des Romans gestrichen wird: In Castorfs Fassung muß sich Franz nicht vor seinen Peinigern verstecken. |
||||
Nicht nur der menschliche Beistand, auch der göttliche wird in Zweifel gezogen. Pessimistisch wird die Erzählung der Opferung Isaaks durch Abraham, die in den Roman montiert ist, umgedeutet. Bei Döblin noch endet die montierte Bibelpassage wie gewohnt mit der Belohnung Abrahams für sein Gottvertrauen: Gottes Stimme unterbricht die Opferung: "Ihr seid gehorsam, hallelujah. Ihr sollt leben." Bei Castorf geht der Vater von einer Rettung durch Gott aus und erklärt seinem Sohn: "Du mußt nur wollen und ich muß es wollen, wir werden es beide tun, dann wird der Herr rufen, wir werden ihn hören: Hör auf. Ja; komm, gib deinen Hals." Doch in der aktualisierten Dramatisierung wartet er vergebens: "Der Vater sticht zu. Gott ruft nicht, Gott ruft nicht. Halleluja. Halleluja." |
||||
Besondere Beachtung verdient das Ende der Dramatisierung, denn es stellt fast eine Verkehrung des Romanschlusses dar. Der Tod tritt als Figur auf; mit dem Gestus eines Wirts, "der seine Kneipe schließt", beginnt er, die Container-Bar aufzuräumen. Dann räumt er mit Franz auf. |
||||
Hier erfolgt eine Umstellung der Handlungsfolge: Im Roman findet zunächst das Gespräch mit dem Tod statt, anschließend wird Franz im Fiebertraum noch einmal den zentralen Figuren, die sein Leben bestimmt haben, gegenübergestellt. Darüber erschließt sich für ihn die Erkenntnis, wann er anders hätte handeln sollen. Die Dramatisierung zieht diese Konfrontation vor. Die Figuren treten real in der Kneipe neben ihn, während Franz zwar geschwächt ist, weil er gerade Miezes Leiche gefunden hat, aber lebt und bei Bewußtsein ist. Es ist bezeichnend, wie sehr sie auch jetzt noch über Franz hinweggehen: Eva versucht, Reinhold dazu zu bringen, sich für den Mord zu entschuldigen -- eine Forderung, die den Mord tatsächlich ins Lächerliche zieht. |
||||
EVA |
||||
Währenddessen trägt Franz Miezes Leiche in die Kneipe, keiner beachtet ihn. Als Eva und Herbert einen Taufpaten für ihr Kind suchen, denken sie sofort an den Mörder Reinhold, Franz hingegen kommt ihnen nicht in den Sinn. |
||||
Die Vorwürfe, die im Roman die Figuren im Fiebertraum an ihn richten, sagen sie dem trauernden Franz in der Dramatisierung später direkt ins Gesicht. Herbert, eigentlich ein Freund, spielt dabei mit Miezes Leiche wie mit einer Puppe, genauso unmenschlich agiert Reinhold, der Franz provozieren will und ihm dazu die Leiche Miezes entreißt, um eine Art Fangspiel zu initiieren. |
||||
REINHOLD |
||||
Und noch einmal wird er der Lächerlichkeit preisgegeben: Cilly, Trude und Pums sehen ihn in der Kneipe sitzen und stellen ihre Diagnose. Mit den Texten der drei Ärzte aus Döblins Roman diskutieren sie auf Zeitschriftenniveau seine Leiden, ohne Franz freilich zu helfen, um anschließend tatenlos zu gehen. |
||||
Nun erst folgt das Gespräch mit dem Tod. Der Text, mit dem der Tod Franz über die Fehler seines Lebens aufklärt, ist dem Roman entnommen: Franz habe nie ein wirklich neues Leben angefangen, sein Handeln nicht in Frage gestellt, sondern krampfhaft an dem festgehalten, was er habe. Doch während im Roman dann ein Erkenntnisprozeß einsetzt, an dessen Ende Franz' Genesung steht und ein neues Leben als "Hilfsportier in einer mittleren Fabrik" sowie die Bestrafung Reinholds durch die Justiz, endet die Dramatisierung hoffnungsloser: Der Tod schneidet Franz das Herz aus der Brust, dieser verläßt unter Schmerzen mit der toten Mieze auf dem Arm die Bar. |
||||
Bei soviel Mißachtung und Grausamkeit von Seiten der Mitmenschen verwundert es nicht, daß ein versöhnliches Ende ausbleibt. Döblin gibt seinem Protagonisten zwei wesentliche Erkenntnisse für die Zukunft mit, die das Licht am Ende des dunklen Weges darstellen. Erstens müsse man sich seines Verstandes bedienen, die Augen offen halten. Soweit erkennt auch der Biberkopf des Dramas seine Fehler. Er hätte den Worten seiner Mitmenschen nicht so einfach trauen sollen. Doch der zweite große Lösungsweg, den Döblin seinem Protagonisten vorschlägt, scheint in Castorfs Fassung nicht mehr zu funktionieren: |
||||
"Er steht zum Schluß als Hilfsportier in einer mittleren Fabrik. Er steht nicht mehr allein am Alexanderplatz. Es sind welche rechts von ihm und links von ihm, und vor ihm gehen welche und hinter ihm gehen welche. Viel Unglück kommt davon, wenn man allein geht. Wenn mehrere sind, ist es schon anders. Man muß sich gewöhnen, auf andere zu hören, denn was andere sagen, geht mich auch an. Da merke ich, wer ich bin und was ich mir vornehmen kann." |
||||
Die Gemeinschaft als Ort der Zuflucht und Selbstkorrektur scheint in Castorfs Version von Berlin Alexanderplatz keine Lösung mehr, nachdem selbst Eva und Herbert, die im Roman noch zu Franz halten, ihn hier beleidigen und ignorieren. Die Vereinzelung scheint normal, das Gemeinschaftsmodell hat versagt. Ein pessimistisches Ende prägt die Dramatisierung. |
||||
Was wäre denkbar gewesen? Ein Deus ex machina, der als Retter in der Not einen Weg oder zumindest eine Lehre bietet. Eine parabelhafte Alternativlösung. Die Andeutung eines Neuanfangs. Die Dramatisierung bietet diese Lösungen dezidiert nicht an und auch kaum eine Perspektive. Obwohl Biberkopf seine Lage erkennen kann, kann sich nicht aus ihr befreien. Bewußtsein allein reicht nicht aus, denn es ist keine Utopie greifbar. Die Situation zeigt sich zwar (hier wieder ganz in brechtscher Manier) als gesellschaftlich 'gemachte' und damit grundsätzlich lösbare, aber als gesamtgesellschaftliches Problem kann sie offenbar nicht von einzelnen überwunden werden. Ob sie gemeinschaftlich oder politisch lösbar wäre, gibt die Dramatisierung nicht vor. Wenn der Haß objektlos wird, wie es Reinhold in der Dramatisierung erklärt, dann ist auch das Denken ziellos. Die Dramatisierung kann so keine 'Sozialrevolution' aufzeigen. Sie öffnet lediglich einen Raum für Diskussion. |
||||
Vom Übertragungsverlust zur Reibungswärme | ||||
Diskussion wird gerade durch die Differenz zur Romanvorlage möglich. Wer den Roman gelesen hat, erlebt über die Geschichte Franz Biberkopfs hinaus die Absage an die Möglichkeit, aus der Position des Unterdrückten zu fliehen, die Absage an ein Modell von Unterstützung durch die Gemeinschaft. Die Handlung wird über wenige Kommentare am gleichen Ort wie damals angesiedelt. Für den Kenner des Romans bietet sich der Vergleich: So könnte es heute aussehen. Und es scheint, als ob mit dem zeitlichen Abstand der Glaube an ein gutes Ende geschwunden ist. |
||||
Die durch Dramatisierung und Umdeutung entstandene Differenz zwischen beiden Texten macht einen Dialog möglich, bei dem sich die Teile gegenseitig kommentieren. Die Übertragung kann damit einen Bedeutungszuwachs hervorbringen -- gerade indem sie sich nicht als möglichst genaue Abbildung der Romanvorlage versteht. Das widerstrebende Element beim Dramatisieren, der Gattungswechsel, erzwingt Veränderung und gibt Anlaß zum Überdenken der Vorlage, zur Neudiskussion und zur Neudeutung. Die Romandramatisierung ist somit immer als Interpretation und Kommentar zur Romanvorlage zu betrachten und wird gerade dort interessant, wo sich Vorlage und Drama durch unterschiedliche Aussagen aneinander reiben. |
||||
Das erklärt auch, warum so viele Fassungen besonders bekannter Romane dramatisiert werden, welche vom bildungsbürgerlichen Theaterpublikum vor der Folie des Romans rezipiert werden können. Wenn eine potentielle Umdeutung von den Rezipienten als solche erkannt wird, kann der Zwang zum 'Übertragungsverlust' durch 'Reibungswärme' positiv genutzt werden. Wo die Fassungen differieren, wo gegensätzliche Positionen vertreten oder bestimmte Haltungen ironisiert werden, wird der zur Schullektüre erkaltete 'Klassiker' wieder diskutiert. Mit der Präsentation im Theater findet die 'Wiederbelebung' an einem Ort statt, der durch gemeinschaftliche Rezeption eine anschließende Diskussion möglich macht. |
||||
Insofern ist die kritisch durchgeführte intertextuelle Bearbeitung eines Romans auch eine Stellungnahme zu bisherigen Praxis seiner Deutung, kann also in die Nähe literaturwissenschaftlicher Betrachtungen von Texten rücken. Hier sei auf Michail Bachtin verwiesen, der in Das Wort im Roman das dialogische Verfahren als Basis literaturwissenschaftlicher Arbeit definiert. |
||||
"In der Philologie ist das dialogische Erkennen obligatorisch (ohne es ist ja kein Verstehen möglich): es allein erschließt neue Momente im Wort (Momente des Sinns im weiteren Sinne), die sich, nachdem sie auf dialogische Weise erschlossen worden sind, verdinglichen. Jedem Fortschritt in der Wissenschaft vom Wort geht ein 'geniales Stadium' voraus -- das verschärfte dialogische Verhältnis zum Wort, das in ihm neue Aspekte erschließt." |
||||
Die hier betonte Nähe zwischen künstlerischer und wissenschaftlicher Betrachtung des fremden Wortes kann sich in der Dramatisierung als eine Form zwischen künstlerischem Ausdruck und Interpretation wiederfinden. |
||||
Black: Ende ohne Ausblick | ||||
Das Stück endet mit einem Monolog Biberkopfs, der einer Passage der Schlachthofbeschreibung aus dem Roman entspricht. Er spricht direkt zum Publikum, erzählt von der Schlachtung eines Stiers, vom quälenden Springen des Schlachtgehilfen auf dem Leib, damit das Blut schneller fließt, und schließlich vom Tod des Tieres. "Das Leben röchelt sich nun aus, der Atem läßt nach. Schwer dreht sich der Hinterleib, kippt." Der letzte Satz, "[f]röhliche Weiden, dumpfer warmer Stall", kann nicht mehr als eine Erinnerung sein, zumal Franz neben Miezes totem Körper steht und es, der Bühnenkonvention folgend, nun schwarz wird -- ein Theaterstück endet im Black. So unterstützen Dramen- und Theaterkonventionen doch noch die umgedeutete Geschichte von Franz Biberkopf. |
||||
|
autoreninfo

Birte Lipinski, geboren 1979, studierte Germanistik und bildende Kunst und ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Germanistik der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Mit dem Theater beschäftigt sie sich in ihrer Doktorarbeit zu Dramatisierungen sowie in ihrer Freizeit als künstlerische Leiterin des Oldenburger Universitätstheaters (OUT).
|
||||
|
|