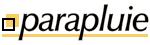
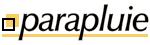 |
elektronische zeitschrift für kulturen · künste · literaturen |
|
no. 26: visuelle kultur
|
AugenschmausDie Hohe Küche des Ferran Adrià und der Ausstellungswert |
||
von Theo Steiner |
|
Sein Restaurant elBulli ist laut New York Times ein gastronomisches "once-before-you-die mecca". In Ferran Adriàs Werkstatt mutiert das alte Handwerk der Kochkunst zu einem kreativen Forschungsprojekt. Der Starkoch experimentiert mit allem Möglichen, das eßbar ist. Adrià ist aber nicht nur ein Meister des Gaumenkitzels. Es gilt auch die raffinierte Gestaltung seiner Speisen zu betrachten. Und natürlich regen die extremen Kreationen ebenso zum Nachdenken über die Eßkultur der Gegenwart an. So entstehen durch Adriàs gastronomische Experimente verschiedene Ebenen, auf denen die Gerichte und die Speisenden interagieren. |
||||
|
||||
"Iiiih, das sieht ja eklig aus!" Meine Frau lief gerade am Schreibtisch vorbei, als ich im Internet nach Bildern für einen Aufsatz über Ferran Adrià suchte. Er ist der Küchenchef des katalanischen Restaurants elBulli und momentan wohl der berühmteste Koch der Welt. Ein Anhänger von Adriàs Molekularküche hatte mit seinem Konzept der Schäume, espumas, experimentiert und einige unbeholfene Fotos seiner Resultate im Netz veröffentlicht. Ekel ist natürlich ein höchst individuelles Gefühl. Von Person zu Person, von Kultur zu Kultur ist es sehr unterschiedlich, was als eklig empfunden wird. Bill Buford etwa, der ehemalige Herausgeber der Kulturzeitschrift Granta, der sich gerade regelrecht ins Koch- und Metzgerhandwerk eingearbeitet hat, findet Tofu widerwärtig, "wie Quallenrotz", was für mich nicht ganz nachvollziehbar ist. Ich wiederum fand in meiner Jugend bei der Lektüre von Heinrich Harrers Sieben Jahre in Tibet einen zwar imaginären, aber doch nachhaltigen Anlaß für Abscheu. Zwar war ich fasziniert von Harrers Abenteuern auf der Flucht aus dem britischen Internierungslager in Indien und von seinen Erfahrungen als Entdeckungsreisender in Tibet, doch extrem abstoßend fand ich die Vorstellung, den gesalzenen Buttertee zu trinken, das tibetische Standardgetränk, von dem Harrer berichtete. Aus Stephen Greenblatts Buch Schmutzige Riten habe ich inzwischen gelernt, daß ein Ethnologe, der sich vor fremden Riten ekelt, sich damit vor allem seiner eigenen, kulturellen Identität versichert. Ob mir dieses Wissen heute helfen würde im Angesicht einer von gastfreundlichen Tibetern angebotenen Schale? |
||||
Im Fall eines Gerichts, das Ferran Adrià kreiert hat, sollte es solche Probleme natürlich nicht geben. Die Bilder des experimentierfreudigen Bloggers, der auf den Spuren des besten Kochs der Welt wandelt, sahen tatsächlich nicht gerade einladend aus. Doch wenn Meister Adrià selbst seine Gerichte dokumentiert, dann beschäftigt er einen der besten Fotografen Kataloniens, Francesc Guillamet. Überdies sind die Kreationen durchwegs kunstvoll zubereitet und arrangiert. Da könnte sich höchstens mal jemand an der bisweilen glibberigen Erscheinung des Essens stoßen. Oder jemand könnte beim kulinarischen Genuß eines Experiments von Adrià ein gewisses Unbehagen verspüren, etwa bei einem Gericht, das nach Meer schmecken soll. |
||||
Dokumente der kulinarischen Kreativität | ||||
Adriàs Kreationen verknüpfen Zutaten in ungewohnter Manier und irritieren unsere Erwartungen beim Essen und Schmecken. Als Roger Buergel ihn 2007 zur Documenta eingeladen hat, hieß es in einem Kurztext über Adrià, daß er "gewohnte Speise-, Geschmacks- und Esserfahrungen" dekonstruiert, daß er mit Stoffen und deren Eigenschaften experimentiert, indem er "Temperatur, Textur, Aggregatzustand und Form" auf neue Weisen komponiert. Der Küchenchef selbst wird mit folgender Definition zitiert: "Eines unserer Prinzipien bei elBulli ist das Wecken neuer Emotionen. Das läuft normalerweise über die Reizung der Sinne". So fabriziert Ferran Adrià mit Hilfe eines Sahnesiphons aus den unterschiedlichsten Lebensmitteln seine legendären Schäume, welche die extrahierten, konzentrierten Aromen transportieren, etwa den Geschmack von Shiitake-Pilzen. Oder er fertigt mittels Vakuum-Trocknung Orangenscheiben, die außen trocken und innen frisch sind. Aus Milchhaut werden Ravioli geformt, Shrimps-Scheiben (Shrimps Sashimi) werden begleitet von einer Ampulle, die den flüssigen Extrakt von Shrimpsköpfen enthält. In seinen Experimenten testet Adrià die einzelnen Formen immer weiter aus: er variiert etwa bei den Schäumen nicht nur das Aroma, sondern auch die Temperatur oder die Dichte, so gibt es auch heiße oder extrem luftige Schäume (texturas aéreas). Bei all diesen innovativen, unkonventionellen Konzepten soll trotz der Hightech-Prozeduren die Reinheit des ursprünglichen Geschmacks erhalten bleiben. Die Ergebnisse der langen Versuchsreihen werden im elBulli jedes Jahr neu in Form eines Degustationsmenüs präsentiert, als eine Reihe von bis zu drei Dutzend kleinen Häppchen. "The menu de dégustation is the finest expression of avant-garde cooking", heißt es in der Synthesis of elBulli cuisine, dem Mission Statement des Restaurants. |
||||
|
Nach der Veröffentlichung von Roger Buergels Künstlerliste wurde viel darüber gerätselt, was von Adriàs Arbeit konkret ausstellenswert ist, was der Küchenchef denn zur Documenta beitragen wird: ein Schaukochen vielleicht oder Fotos von seinen Kreationen, 'Meal Stills' sozusagen? Gänzlich unerwartet präsentierte er schließlich ein Reise-und-Speise-Arrangement: Während der gesamten Ausstellungsdauer wurden täglich zwei Besucher vom künstlerischen Leiter der Documenta persönlich ausgewählt, um in Adriàs Restaurant zu speisen. Der Titel dieses Werks lautete documenta 12 en elBulli. Nachdem das elBulli während der Ausstellungsdauer an rund 70 Tagen geöffnet hatte, kamen von der Dreiviertelmillion Besucher der Documenta schätzungsweise 140 Menschen in den Genuß "der authentischen Erfahrung eines Abendessens bei [sic] elBulli" [Anm. 1] und konnten auf diese Weise ihren Kasseler Ausstellungsrundgang erweitern. Gerade einmal 0,02% des Publikums wurden zu realen Gaumenzeugen seiner Kochkunst. Wie setzen wir anderen uns mit einem Ereignis auseinander, das wir verpaßt haben, und welches auch so gut wie gar nicht dokumentiert ist? |
|||
Es gibt keine dokumentarischen Fotos, keine Handlungsanweisungen wie im Fall von Erwin Wurms Five Minute Sculptures, keinen Film im Stil von Louis Malles Mein Essen mit André, der uns zeigen würde, wie sich die beiden Speisenden unterhalten. Das Ereignis der Teilnahme Ferran Adriàs an der Documenta war in diesem Sinne also kein öffentliches "Eräugnis" [Anm. 2], kein Zeigen und Vor-Augen-Stellen. All jenen, die documenta 12 en elBulli nicht erfahren konnten, wurde auf der Homepage der Ausstellung mitgeteilt: "Wer nicht in den direkten Genuss von Ferran Adriàs Kompositionen kommt, dem sei an dieser Stelle der täglich wechselnde Menuplan Inspiration." Tröstlicher erschiene es mir da, die Tatsache ins Gedächtnis zu rufen, daß bei den sagenhaften Performances einer Marina Abramovic oder eines Chris Burden meist auch nur wenige Menschen anwesend waren. Diese Performances sind aber immerhin durch Fotografien und Berichte für die Nachwelt dokumentiert worden. |
||||
Die Aktion im elBulli zu dokumentieren, so wie wir die historischen Performances durch Dokumente und Relikte kennen, das hätte allerdings im Kontext der Documenta wohl nur fatale Folgen haben können. Die Neigung des gastronomischen Unternehmens elBulli zur Fetischisierung der eigenen Waren sowie zum Abklatsch kunsthistorischer Vorbilder hätte die visuelle Dokumentation des Ereignisses kaum zu einem würdigen Documenta-Beitrag gemacht. Der Großteil des Documenta-Publikums, der von der Performance im elBulli ausgeschlossen blieb, wurde dafür zu Nachdenkprozessen angeregt, zum Beispiel über den aktuellen Fetischismus rund ums Essen, über Exklusion und Exklusivität in der Kunstwelt oder über die Frage, ob die Kunstwelt damit zum Kulinarischen hin erweitert wurde. Somit liegen die Stärken dieses Kunstwerks nicht im visuellen, sondern im konzeptuellen Bereich. Für den Kernbereich von Ferran Adriàs Aktivitäten stellt sich die Sache natürlich anders dar. |
||||
Auf dem Präsentierteller | ||||
Neben den kulinarischen Innovationen, den unerwarteten aromatischen Sensationen spielt die visuelle Präsentation der Gerichte eine zentrale Rolle. Und dabei geht es nicht nur darum, daß ein kreativer Koch seine Erfindungen eben im Medium Kochbuch dokumentiert und sich damit das Copyright sichert. Die visuellen Präsentationen erfüllen darüber hinaus eine weitere soziokulturelle Funktion: sie signalisieren, daß den Gerichten ein außergewöhnlicher Status zukommt. |
||||
Die ungewöhnlichen Dinge, welche im elBulli angeboten werden, sind zuerst einmal recht exklusiv, um nicht zu sagen praktisch kaum erhältlich. Bei der Onlinebuchung erhaschen jedes Jahr von den hunderttausenden Interessenten nur die ersten 8000 innerhalb des schmalen Zeitfensters eine Tischreservierung. Auf elbulli.com wird zwar mit Animation, Sounds und Slogans kräftig die Werbetrommel für das Catering und den hauseigenen Verlag gerührt, das Restaurant dagegen wird vergleichsweise spartanisch, geradezu geheimniskrämerisch abgehandelt. Systematisch soll offenbar der Reiz des Besonderen gesteigert werden. Wenn es stimmt, daß sogar eine Million Menschen pro Jahr in Ferran Adriàs Restaurant speisen möchten, dann beträgt die Wahrscheinlichkeit zum Verzehr der ungewöhnlichen Speisen zugelassen zu werden 1:125. Zum Vergleich, für Besucherinnen und Besucher der Documenta betrug die Wahrscheinlichkeit, den externen 'Pavillon' in Roses bei Barcelona besuchen zu dürfen, sogar nur 1:5357. Gemessen an dieser Knappheit des Angebots ist ein Menü im elBulli eigentlich relativ preiswert: Im Jahr 2007 kostete das Degustationsmenü mit seinen rund drei Dutzend Gängen 185.- Euro. Doch die künstliche Verknappung führt zu einer enormen Hochschätzung der Waren, in der Fachwelt ebenso wie bei der potentiellen Kundschaft. In diesem Sinne erscheint es angemessen, die ungewöhnlichen Dinge aus dem elBulli als Kultobjekte zu bezeichnen. |
||||
Verehrt werden in diesem Fall keine Beispiele außergewöhnlichen Designs für den alltäglichen Gebrauch (wie der Citroën DS), auch keine Schauspieler, Sportler oder Musiker mit ihren Fanartikeln, sondern die Kreationen "des einflussreichsten Küchenchefs unserer Zeit", so die Verlagswerbung zu Manfred Weber-Lamberdières Die Revolutionen des Ferran Adrià. Die Speisen eines elBulli-Menüs sind Fetische von Anhängern des besonderen Essens, das Goldene Kalb des food fetishism. Der Kult rund um den besten Koch der Welt bindet seine Kreationen in einen rituellen Gebrauch und eine ästhetische Inszenierung ein. Diese Funktionen können wir anhand von Walter Benjamins Kategorien 'Kultwert' und 'Ausstellungswert' beleuchten. |
||||
Kultisches Verzehren | ||||
Die Eßwaren des elBulli weisen nicht nur einen profanen Gebrauchswert auf, dienen nicht nur der Sättigung, Stärkung oder Heilung, sondern sie werden vom Koch und seiner Fangemeinde mit einer besonderen Aura aufgeladen. Welche Bedürfnisse soll denn Adriàs Kultküche befriedigen? Neben dem Verlangen der Kundschaft nach einem raren, exklusiven Genuß geht es wohl hauptsächlich um die Sehnsucht dieser Menschen, an einem Gemeinschaftsereignis kultischer Art teilzunehmen. In seiner Studie Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit beschreibt Benjamin mit dem Begriff 'Aura' die quasi religiöse Ausstrahlung großer Kunst. Er versteht darunter die "einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah sie sein mag. An einem Sommernachmittag ruhend einem Gebirgszug am Horizont oder einem Zweig folgen, der seinen Schatten auf den Ruhenden wirft." |
||||
Insofern moderne Werke in neuen Medien und Techniken massenhaft produziert werden und reproduziert werden können, gehen sie der Qualität des Auratischen verlustig. Ursprünglich ist das Werk in ein Ritual eingebettet gewesen, hat wegen seiner Funktion in diesem magischen oder religiösen Kontext einen Kultwert besessen. Höhlenmalerei, Götterstatuen, Madonnenbilder -- "Kunst vor der Kunst" hat Hans Belting diese Art von Werken mittlerweile treffend genannt. Das moderne Kunstwerk könnten wir deshalb in Abwandlung von Beltings Formel als "Kunst nach dem Kult" bezeichnen. Benjamin sah eine entscheidende Differenz zwischen dieser modernen Art von Kunst und ihren rituell eingebundenen Vorläufern: während es bei den Kultgegenständen wichtiger gewesen sei, daß sie vorhanden sind, sollen Kunstwerke im modernen Sinn in erster Linie angeschaut werden -- das ist ihr Ausstellungswert. |
||||
Für seine eigene Zeit sah Benjamin eine neue Ära angebrochen. Der 'Schönheitsdienst', der von der Renaissance bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts gepflegt worden war, sei durch die Entwicklung der Fotografie zu einem Ende gekommen. Die Fotografie, welche nach Benjamins Befund im Kern bereits das Potential des Tonfilms enthält, bricht nämlich mit dem traditionellen Kunstkriterium der Einzigartigkeit: die Fotografie ist, wie der Film, ein reproduzierbares Werk. Mit dieser Art von Werken ändert sich zugleich die Rezeption, denn während Gemälde fast durchwegs von einzelnen oder wenigen Personen betrachtet werden, können Fotografien von vielen Menschen simultan -- im Fall eines Films sogar von einer großen Gruppe im Kollektiv -- angesehen werden. Durch die Präsentier- und Transportfähigkeit ergibt sich der Ausstellungswert dieser Werke. |
||||
Benjamins Gegenüberstellung von Kultwert und Ausstellungswert ist jedoch bis zu einem gewissen Grad eine irreführende Dichotomie. Denn wie uns der aktuelle Boom des Museums- und Ausstellungswesens lehrt, erzeugt gerade das Ausstellen der Werke deren Kultwert. Für unseren Fall der eßbaren Werke des Küchenchefs Adrià sollten wir daraus den Schluß ziehen, daß dieser Kult als gesellschaftlicher und kultureller Prozeß des kommunikativen Handelns untersucht werden muß. Fruchtbar erscheint Benjamins Ansatz aber jedenfalls insofern, als er der Tatsache Rechnung trägt, daß rituelle Gegenstände, Fetische und Kunstwerke in mancher Hinsicht ähnlich gebraucht werden. Treffend bezeichnet Benjamin den modernen Ausstellungsbesuch als fetischistischen Schönheitsdienst, mithin als säkularisierte Version der magischen oder religiösen Kulte. |
||||
Der Gipfel der Kochkunst | ||||
Adriàs Kult um außergewöhnliches Essen ist natürlich kein Kult im klassischen Sinn des 'religiösen Felds' (Bourdieu), er gehört auch nicht zu den Übergangsriten, 'rites de passage', wie Arnold van Gennep die zeremoniell geordneten Initiationen und Rollenwechsel genannt hat. Adriàs Kult ist vielmehr zur Gruppe der 'Mußegattungen' zu rechnen. Mit diesem Ausdruck beschrieb der Ethnologe Victor Turner die moderne Schwundstufe der traditionellen Schwellensituationen. In spannungsgeladenen Freizeitaktivitäten kann der moderne Mensch aus der Routine ausbrechen oder auf symbolische Weise Krisenmanagement betreiben. Die Mußegattungen sind im Gegensatz zu den Übergangsriten individualisiert, sie bieten dem einzelnen aber dennoch ein ozeanisches Gefühl der Verbundenheit, mit anderen Menschen, mit der Natur. Sie stillen den Erlebnishunger, dies allerdings nicht selten nur um den Preis eines totalen Engagements oder jedenfalls großer Hingabe. Denken wir nur an den Aufwand, den man für eine Tischreservierung im elBulli treiben muß. Ferran Adriàs Kult um das außergewöhnliche Essen ist in diesem Sinne als modernes Ritual zu verstehen. |
||||
|
Im elBulli werden die Gerichte zwar häufig mit Hightech-Mitteln zubereitet, doch es ist weniger ihre Art der Reproduktion, die für ihre rituelle Funktion relevant ist, als vielmehr die Art ihrer Rezeption. Diese erfolgt, was die Sinnesorgane betrifft, auf zwei verschiedenen Bahnen, zum einen über die Nahsinne, das Schmecken und Riechen, und zum anderen über das Sehen, den Fernsinn par excellence. Nehmen wir zuerst die Erfahrung mit den Nahsinnen. Für die von Roger Buergel in Kassel ausgewählten Personen wird das elBulli zum externen Pavillon der Documenta. Durch und für diese besondere Gruppe von Speisenden mutiert das gemeinsame Verzehren der eßbaren Experimente zum Kunstgenuß. In der Kunstwelt mit ihrer vorrangig visuellen Orientierung bleibt ein Werk meist in materieller Hinsicht unangetastet. Und daraus entsteht die Suggestion, daß alle dasselbe Werk erfahren können. Anders im Fall von documenta 12 en elBulli: die Menüabfolge ist zwar für alle Speisenden gleich und jeder Gast erhält dieselbe Anzahl und Art von Gängen. Doch auch wenn für alle Gäste nach denselben Rezepten gekocht wird, so ist doch die Rezeption der zum Verzehr bestimmten 'Multiples' unaufhebbar individuell. |
|||
Die Häppchen des Degustationsmenüs werden nicht nur von den Fernsinnen wahrgenommen, sondern vor allem mit dem Mund aufgenommen. Der Körper jeder speisenden Person fungiert als Instanz oder Akteur des Eßvorgangs und produziert dabei subjektive Phänomene, Geschmacksempfindungen, wofür der Initiator des Rituals nur, oder wenn man so will 'nur', die Rahmenbedingungen liefern kann. Das rituelle Wissen, das nicht durch losgelöste Betrachtung, sondern durch die Handlungen der Speisenden entsteht, entzieht sich jedenfalls bis zu einem gewissen Grad der Voraussicht und Kontrolle des 'Autors' Adrià. |
||||
Der Verzehr, das Verschlingen des ephemeren Produkts löst das materielle Substrat von Adriàs Kunstwerk auf und verhindert auf diese Weise jegliche Anwandlung eines bewahrenden Objektfetischismus, wie er ansonsten unser Museums- und Ausstellungswesen prägt. Ferran Adrià hat also mit seinem Abstecher in die Kunstwelt, der genaugenommen ein Abstecher der Kunstwelt in sein Restaurant war, eine gastronomische Performance und eine Kritik des Werkbegriffs geschaffen. Nicht nur die Auflösung des materiellen Substrats spielt dafür eine Rolle, sondern vor allem die zentrale Stellung des kulinarischen Empfindens. Und dies gilt nicht nur für die von der Documenta entsandten Gäste des elBulli, sondern für alle, die dort speisen. |
||||
Im Zeichen des Essens | ||||
Die Rezeption von Adriàs Werken weist noch eine weitere Besonderheit auf. Die Werke sind nicht so ohne weiteres transportabel wie jene technisch reproduzierbaren Arbeiten, an die Walter Benjamin gedacht hat, wie die Kopie eines Films etwa. Die Präsentation der Eßwaren im elBulli ist an den besonderen Ort gebunden, und das nicht nur wegen der Infrastruktur, die dort im Lauf der Jahre aufgebaut worden ist. Die speisenden und wissenden Körper sind ungeachtet der Subjektivität und Individualität ihrer Empfindungen keineswegs isolierte Monaden. Durch ihre gemeinsame Teilnahme an ein und derselben rituellen Handlung verlieren sie ein gutes Stück weit ihre Individualität und bilden eine spezifische Gemeinschaft in Raum und Zeit -- das könnten wir ihren persönlichen Kultwert nennen. Sie gehen gewissermaßen auf in dem Kollektivkörper, der sich Adriàs Kreationen einverleibt. Dieser metaphorische Körper entsteht durch die Interaktionen an dem besonderen Ort und durch die Wahrnehmungen zweiter Ordnung -- das Sehen und Gesehenwerden, das Wissen, daß man gemeinsam an einem besonderen Ereignis teilnimmt. Daraus resultiert der persönliche Ausstellungswert der Gäste. Wie im Fall eines Kunstwerks sind also auch beim Menschen Kultwert und Ausstellungswert miteinander verschränkt. |
||||
Neben phänomenologischen und anthropologischen Betrachtungen ist auch eine semiotische Sicht auf die Beteiligten angebracht. Denn wer im elBulli speist, partizipiert an einer außergewöhnlichen Choreographie -- an einer ästhetischen Inszenierung, an einem Versuch, den Alltag zu überwinden oder zu überbieten, und damit an einem Akt der Selbstdarstellung. Die am Ritual beteiligten Körper sind nicht nur Orte subjektiver Phänomene, sondern auch Elemente eines kommunikativen Prozesses. Die Gäste gewinnen neben ihren außergewöhnlichen ästhetischen Erlebnissen vor allem ein besonderes Distinktionsmerkmal -- sie gehören zu einer verschworenen Gemeinde von 'Food-Fetischisten', die sich durch besonderes Essen auszeichnen. Sie grenzen sich von jenen Menschen ab, die nur 'normales' Essen zu sich nehmen. Das gilt auch für jene Anhänger, die bei der Reservierungslotterie leer ausgehen oder nicht mitmachen, bloß daß denen die 'höheren Weihen' eines Besuchs im Gourmettempel fehlen. |
||||
Bekennende Eßfetischisten | ||||
All jenen, die keine Tischreservierung ergattern, bleibt nur die Schiene des gewöhnlichen Starkults. Sie begnügen sich vielleicht mit Reproduktionen und lassen sich in Adriàs Luxushotel Hacienda Benazuza in Sevilla Gerichte der vergangenen Jahre servieren. Sie kaufen sich Bildbände, die Adriàs kulinarische Arbeit dokumentieren und mit Copyright versehen. Oder sie besorgen sich kleine Experimentierkästen mit den Zutaten für einige seiner Gerichte, um diese selbst nachzukochen. So wie sich andere Fans ein T-Shirt mit dem Bild ihres Pop-Idols kaufen, beschaffen sie sich die Bildbände als Devotionalien oder die Zutaten als Requisiten eines reenactment. Es gibt eine stattliche Zahl von Food-Fetischisten, die Adriàs Gerichte nachkochen. Sie vermischen etwa nach seiner Methode der 'sferificación' Melonensaft mit Alginat und Natriumcitrat, tropfen die Mischung dann in eine Kalziumchloridlösung und fabrizieren dadurch kaviarähnliche Kügelchen. Und wenn sie sich die von Adrià angebotenen Kochbücher, Zutaten und Geräte nicht leisten können, dann suchen sie im Internet nach kostenlosen Rezepten, etwa auf der Seite Kochende Leidenschaft, einer Tauschbörse für Rezepte und Koch-Infos, oder sie tauschen sich darüber aus, wie man die nötigen Zutaten selbst kostengünstig herstellen kann. |
||||
|
Ob sie nun an dem Ritual im elBulli teilnehmen können oder nicht, für alle Anhänger Adriàs ist neben der Zugehörigkeit zur Gruppe der Gleichgesinnten noch ein weiteres Distinktionsmerkmal wichtig, nämlich die Suggestion an jenem Modell der persönlichen kreativen Freiheit teilzuhaben, wie es der kulinarische Unternehmer und Starkoch verkörpert. Die Wirtschaftswissenschaftler Planellas und Svejenova überliefern dazu folgende Stellungnahme Adriàs: "I'm not a businessman. In fact, I don't even like business. I've done this, quite simply, to achieve creative freedom". Die Molekularküche ist, wie sein Beispiel zeigt, nicht nur eine Mode zum Essen, sondern auch eine Methode zur Gestaltung des eigenen Lebens. Aber werden Adriàs Anhänger deshalb gleich zu Ko-Autoren seiner Kreationen und zu Kompagnons seiner Lebenskunst-AG? Vielleicht sind sie doch nur "dedicated followers of fashion" wie jene Kleidungsfetischisten, von denen The Kinks 1969 gesungen haben. Dann gilt für sie natürlich auch Hartmut Böhmes lakonisches Resümee über die Mode zum Anziehen: Mode ist "die fetischistische Beschwörung eines gelungenen Lebens, aber gelingen tut stets nur die Mode selbst, nicht das Leben". Und der Ethnologe, der all diese Bräuche 'von ferne' beobachtet? Der muß sich fragen "Was koche ich denn heute?". |
|||
|
||||
Dieser Beitrag beruht auf Material aus zwei Aufsätzen des Autors über den spanischen Meisterkoch: 1) Verklärung des Ungewöhnlichen. Die Hohe Küche des Ferran Adrià als Kunstwerk. In: Bast, Gerald (Hrsg.); Felderer, Brigitte (Hrsg.): ART and NOW. Über die Zukunft künstlerischer Produktivitätsstrategien. Wien 2008; 2) Aroma mit Aura. Die Hohe Küche des Ferran Adrià als Kult. In: Friedrich, Thomas (Hrsg.); Schwarzfischer, Klaus (Hrsg.): Wirklichkeit als Design-Problem. Zum Verhältnis von Ästhetik, Ökonomik und Ethik, Würzburg 2008. |
||||
|
autoreninfo
Dr. Theo Steiner lebt als freier Dozent und Autor in Heidelberg. Studierte Philosophie bei Rudolf Haller in Graz und arbeitete in den 1990er Jahren als Kurator an der Kunsthalle Wien. Es folgten Lehraufträge an der Universität für Angewandte Kunst Wien und Symposien (Ereignisgesellschaft; Genpool; Barbaren). Derzeit unterrichtet Theo Steiner am Zentrum für Angewandte Kulturwissenschaft der Universität Karlsruhe und an der Merzakademie/Hochschule für Gestaltung in Stuttgart.
|
||||
|
|