Neuer Roman des „Vorleser“-Autors
Presseschau vom 27. Februar 2008
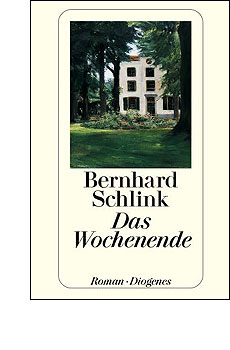 BERLIN (BLK) – Die „Süddeutsche Zeitung“ rezensiert Bernhard Schlinks neuen Roman „Das Wochenende“. Die „FAZ“ bespricht einen Führer der Psychiatriemuseen Europas. Die „NZZ“ lobt Urs Widmers Frankfurter Poetikvorlesungen. Außerdem in der Presseschau: Michael Erler, Lisa Lutz und „Die Einsamkeit des Thomas Cave“.
BERLIN (BLK) – Die „Süddeutsche Zeitung“ rezensiert Bernhard Schlinks neuen Roman „Das Wochenende“. Die „FAZ“ bespricht einen Führer der Psychiatriemuseen Europas. Die „NZZ“ lobt Urs Widmers Frankfurter Poetikvorlesungen. Außerdem in der Presseschau: Michael Erler, Lisa Lutz und „Die Einsamkeit des Thomas Cave“.
„Frankfurter Allgemeine Zeitung“
Psychotherapeut Rolf Brüggemann und Kunsttherapeutin Gisela Schmid-Krebs haben einen Führer der Psychiatriemuseen in Europa herausgegeben, informiert die „FAZ“. Sie wollten mit ihrem Band „öffentlich zugängliche Orte aufsuchen, die das Seelenleben am Rande seiner Wirklichkeit zeigen“. Gemessen an diesem Anspruch überzeuge das Buch nicht, findet die „FAZ“. Der Versuch, die jeweiligen Ausstellungskonzepte begrifflich zu durchdringen sei nicht erkennbar, außerdem mangele es den Autoren an sprachlichem Ausdrucksvermögen. So mündeten viele Museumsbesuche in „beredte Allgemeinplätze“. Des Weiteren fehlten dem Band vertiefende Literaturhinweise, Informationen über die Anfahrt, aber auch ein Personen- und Sachregister.
In Lisa Lutz’ Roman „Little Miss Undercover“ bleibe „bis zur letzten Zeile Selbstgenügsamkeit vorherrschend“, schreibt die „FAZ“. Es gehe darin um die Familie Spellman, bestehend aus Vater, Mutter, zwei Töchtern einem „Überfliegerbruder“ und einem „Säuferonkel“. Nirgends finde sich eine Bezugnahme „auf eine wie auch immer geartete, unter den Einfällen liegende Idee“. So gut die Autorin das lakonische Erzählen beherrsche, bleibe der Roman auf einem „Komik-Level“, dessen Stil eintönig wirke. Eine „Soap-Ästhetik“ präge das Buch der kalifornischen Jungautorin Lutz. Die „FAZ“ fragt sich, was man mit einem bedeutungslosen Roman mache und behauptet im Resümee: „Verfilmen, jede Wette.“
Angesichts ihrer historischen Bedeutung sei es erstaunlich, dass dem Innenleben und der Außenwirkung von NSDAP und SED lange wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde, schreibt die „FAZ“. Insofern sei Mario Niemanns Studie „ Die Sekretäre der SED-Bezirksleitungen 1952-1989“ zu begrüßen. Jedoch sei sein Buch von „lexikalischer Trockenheit“. Das wirkliche Leben in den 15 DDR-Bezirken sei in diesem Buch wenig greifbar. Vielmehr bestätige es, was man schon wusste, nämlich dass die Gauleiter der NSDAP über eine ungleich größere Machtfülle und Gestaltungsfreiheit verfügten als die gut angepassten SED-Bezirkschefs. Über den Herrschaftsalltag der Bezirksleiter erfahre man so gut wie nichts, beklagt der Rezensent.
Die Lektüre von Harald Müllers „Wie kann eine neu Weltordnung aussehen“ vermittle einen zwiespältigen Eindruck, schreibt die „FAZ“. Das liege an der „Mixtur aus Realismus und Utopie“ des Buches. Bemerkenswert seien die Realismus-Anteile des Buches, obgleich auch der Utopie-Part zur Geltung komme. Müllers „Hohelied auf die Zivilgesellschaft“ münde zuletzt in emphatische Aufforderung an jeden Einzelnen, sich gesellschaftlich und politisch zu engagieren. Müller fordere in seinem Werk mit der Verschiedenheit in der Welt konstruktiv umzugehen, vereinbarte Vorstellungen von Gerechtigkeit zu verwirklichen sowie den „großen Krieg“ zu verhindern.
Mark Buchanans Buch„Warum die Reichen immer reicher werden und ihr Nachbar so aussieht wie sie“ sei herzerfrischend, lobt die „FAZ“, behauptet gleichzeitig aber, dass mit dem Buch nichts gewonnen sei. Buchanan nehme altbekannte Phänomene und suche in der Physik Modelle, um diese zu erklären. So rate er dazu, sich Menschen wie Atome vorzustellen. Insgesamt liefere der Sozialphysiker zu wenig an neuen Erkenntnissen. Man möchte seiner These, menschliches Verhalten sei nicht so kompliziert wie immer behauptet, gerne glauben, doch vieles habe schon die Bibel oder Karl Marx erklärt, schreibt die „FAZ“.
„Neue Zürcher Zeitung“
Der Autor des Buches „Kopernikus in der Verbotenen Stadt“, Rainer-K. Langner, bezeichne den Protagonisten seiner Biografie Johannes Schreck als „wichtigsten Vertreter der europäischen Naturwissenschaft“ und als „Vertreter der Kooperation der Kulturen“, meint die „NZZ“. Der 1576 geborene Schreck zog als Missionar mit seinem Jesuitenorden über Indien nach China, berichtet der Rezensent Ludger Lütkehaus. Dort habe er jedoch primär als „Missionar der Wissenschaft“ agiert, behauptet Lütkehaus und weist auf den hypothetischen und spekulativen Charakter des Buches hin, der in dem Mangel an Beweisen begründet ist.
Die „NZZ“ rezensiert das Romandebüt „Die Einsamkeit des Thomas Cave“ von Georgina Harding und bezeichnet es als „eindrucksvoll“. Auf Grund einer Wette wolle der Walfänger Thomas Cave im Jahre 1616 alleine an der grönländischen Küste überwintern, schreibt der Rezensent Martin Zähringer. Vergiftet von dem Verzehr einer Eisbärenleber sieht er seine verstorbene Gattin vor sich. Harding beherrsche die „historische Recherche, genaue Naturschilderung und die Dramaturgie extremer psychischer Belastung gleichermaßen“, findet Zähringer.
Der weit ausholende Titel von Urs Widmers Poetikvorlesungen „Vom Leben und Tod und vom Übrigen auch dies und das“ annonciere, dass Widmer sich viel vorgenommen habe, schreibt die „NZZ“. Im vergangenen Wintersemester (2006/07) hielt Widmer fünf Vorlesungen an der Frankfurter Goethe Universität, wo er seine Ankündigung präzisiert hätte. Aus seinem reichen Fundus von vier Jahrzehnten Schriftstellerexistenz schöpfe Widmer mit Gewinn. Gute Anekdoten und die Schärfung für den Blick, was gelegentlich vergessen werde, enthielten das Buch. So weise Widmer auf den gegenwärtigen Sprachgebrauch hin, welcher durchsetzt sei mit der Sprache der Ökonomie und einem Jargon, der keine Widersprüche benennen könne und so jede Ambivalenz unmöglich mache.
Hartmut von Hentig habe „die frühen Jahre der Bundesrepublik Deutschland über alle Parteigrenzen hinweg kulturell und politisch geprägt“, meint die „NZZ“ und rezensiert seine Memoiren „Mein Leben – bedacht und bejaht“. Der erste Band widme sich seiner Kindheit und Jugend und der zweite der „Schule, Polis, Gartenhaus“, teilt der Rezensent Micha Brumlik mit. Man könne das Werk als „wertvolle Quelle zur Geschichte der geistesaristokratischen Elite der frühen Bundesrepublik als auch als Bericht über ein bewusst geführtes Lebensprojekt lesen“, findet Brumlik.
„Süddeutsche Zeitung“
Bernhard Schlink frage in seinem neuen Roman „Das Wochenende“ nach „der Wahrheit der RAF-Sympathisanten“, teilt die „SZ“ mit. Protagonist und Terrorist Jörg treffe am ersten Wochenende nach 24 Jahren Haft auf seine ehemaligen Mitstreiter, behauptet Rezensent Burkhard Müller. Seine alten Weggefährten, mittlerweile zwischen Mitte und Ende fünfzig und beruflich etabliert, diskutierten in Klassentreffen-Atmosphäre über das „höchst vage benannte ‚linke Projekt’“, schreibt Müller. Schlink folge in dem Roman „der routinierten Dramaturgie des Fernsehspiels“, findet der Rezensent und wünscht ihm gleiches Schicksal wie dem Vorgängerwerk „Der Vorleser“: „Schullektüre soll es werden.“
Der „Ueberweg“ sei längst ein „renommiertes Standardwerk“ geworden, behauptet die „SZ“ und weist darauf hin, dass aus den ursprünglichen drei Bänden in der modernen Neubearbeitung über vierzig geworden seien. Michael Erler bemühe sich in seinem Platon-Band um ein „entschiedenes Einerseits-Andererseits“ und versuche, die Diskussion ausgewogen zu halten, findet Rezensent Thomas Schirren. Dabei sei auch viel Sorgfalt „auf eine Dokumentation der Quellen gelegt worden“, schreibt Schirren weiter. (tan/wag/wip)
Literaturangaben:
BRÜGGEMANN, ROLF / SCHMID-KREBS, GISELA: Verortungen der Seele – Locating the Soul. Psychiatriemuseen in Europa – Museums of Psychiatry in Europe. Deutsch-Englisch. Übersetzt von Martin Pessak und Leah Mays-Krebs. Mabuse-Verlag, Frankfurt am Main 2007. 205 S., Abb., 29,90 €.
BUCHANAN, MARK: Warum die Reichen immer reicher werden und ihr Nachbar so aussieht wie sie. Neue Erkenntnisse aus der Sozialphysik. Aus dem Englischen von Birgit Schöbitz. Campus Verlag, Frankfurt am Main 2008. 262 S., 24,90 €.
ERLER, MICHAEL: Platon. Grundriss der Geschichte der Philosophie, begründet von Friedrich Ueberweg. Die Philosophie der Antike, Band 2/2. Schwabe Verlag, Basel 2007. 792 S., 112 €.
HARDING, GEORGINA: Die Einsamkeit des Thomas Cave. Aus dem Englischen von Beatrice Howeg. Verlag Bloomsbury Berlin, Berlin 2007. 255 S., 19,90 €.
HENTIG, HARTMUT VON: Mein Leben – bedacht und bejaht. Kindheit und Jugend. Band 1. Carl Hanser Verlag, München 2007. 413 S., 24,90 €.
---: Mein Leben – bedacht und bejaht. Schule, Polis, Gartenhaus. Band 2. Carl Hanser Verlag, München 2007. 672 S., 25,90 €.
LANGNER, RAINER-K.: Kopernikus in der Verbotenen Stadt. Wie der Jesuit Johannes Schreck das Wissen der Ketzer nach China brachte. Verlag S. Fischer, Frankfurt am Main 2007. 313 S., 19,90 €.
LUTZ, LISA: Little Miss Undercover. Ein Familienroman. Aus dem Amerikanischen von Patricia Klobusiczky. Gustav Kiepenheuer Verlag, Berlin 2008. 366 S., 16,95 €.
MÜLLER, HARALD: Wie kann eine neue Weltordnung aussehen? Wege in eine nachhaltige Politik. Herausgegeben von Klaus Wiegandt. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt 2008. 520 S., 9,95€.
NIEMANN, MARIO: Die Sekretäre der SED-Bezirksleitungen 1952-1989. Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn 2007. 446 S., 39,90 €.
SCHLINK, BERNHARD: Das Wochenende. Roman. Diogenes Verlag, Zürich 2008. 225 S., 18,90 €.
WIDMER, URS: Vom Leben und Tod und vom Übrigen auch dies und das. Frankfurter Poetikvorlesungen. Diogenes Verlag, Zürich 2007. 153 S., 18,90 €.
Presseschau vom 26. Februar 2008
Andere Stimmen
- Das Ende des Mythos Arktis | Georgina Hardings Romandebüt „Die Einsamkeit des Thomas Cave“
- Ein terroristisches Klassentreffen | Bernhard Schlinks neuer Roman „Das Wochenende“
Rezensionen im Original
- Georgina Harding: Die Einsamkeit des Thomas Cave (Bloomsbury) / Kritik „NZZ“
- Hartmut von Hentig: Mein Leben – bedacht und bejaht. (Hanser) / Kritik „NZZ“
- Rainer-K. Langner: Kopernikus in der Verbotenen Stadt. (S.Fischer) / Kritik „NZZ“
- Urs Widmer: Vom Leben, vom Tod und vom Übrigen auch dies und das. (Diogenes) / Kritik „NZZ“
Verlage
- Bloomsbury Berlin
- Campus Verlag
- Carl Hanser Verlag
- Diogenes Verlag
- Ferdinand Schöningh Verlag
- Fischer Taschenbuch Verlag
- Gustav Kiepenheuer Verlag
- Mabuse-Verlag
- Schwabe Verlag
- S. Fischer Verlag