Über die Freundschaft von Rudi und Ulrike
„Rudi und Ulrike“ von Jutta Ditfurth: ein lebendiges Stück Zeitgeschichte
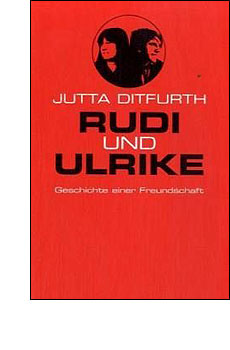 MÜNCHEN (BLK) – 2008 ist Jutta Ditfurths biografisches Sachbuch „Rudi und Ulrike. Geschichte einer Freundschaft“ beim Droemer Verlag erschienen.
MÜNCHEN (BLK) – 2008 ist Jutta Ditfurths biografisches Sachbuch „Rudi und Ulrike. Geschichte einer Freundschaft“ beim Droemer Verlag erschienen.
Klappentext: Eine Freundschaft, die die Republik veränderte
Nur zwei Jahre lang, von 1967 bis 1969, verliefen die Wege von Ulrike Meinhof und Rudi Dutschke parallel. Sie wurden Freunde, davon handelt diese Geschichte. Es ist eine Geschichte über eine Zeit, in der viele Linke sich wie „Freiwild“ vorkamen und deshalb beschlossen, sich zu wehren – notfalls auch mit Waffengewalt. Über den Weg in die Illegalität dachte Rudi Dutschke noch 1969 nach – ein Jahr nachdem ein Attentäter ihn mit drei Schüssen schwer verletzt hatte und ein Jahr bevor Ulrike Meinhof sich für den „bewaffneten Kampf“ entschied.
„Ist es ein Wunder, dass sie ausgerechnet auf ihn geschossen haben? Den mir liebsten unter meinen politischen Freunden.“ Ulrike Meinhof im April 1968
Die Bundesrepublik im Jahr 1967: Hohe gesellschaftliche Positionen und höchste Staatsämter sind von alten Nazis besetzt, es herrscht ein autoritäres Klima. In der „Frontstadt“ Westberlin, wo die APO aufbegehrt gegen den „Muff von tausend Jahren“, gegen Vietnamkrieg und Schahbesuch, werden der rebellischen Jugend von Senatsseite offen Prügel angedroht. Die Polizei versteht sich als verlängerter Schlagstock der Obrigkeit, die Medien des Springerkonzerns heizen die Stimmung zusätzlich an. Das ist die Atmosphäre, in der am 2. Juni 1967 Benno Ohnesorg von einem Polizisten erschossen wird, das sind die Verhältnisse, gegen die Ulrike Meinhof mit ihren Artikeln in konkret anschreibt, die Verhältnisse, gegen die Rudi Dutschke mit seinen leidenschaftlichen Reden auftritt.
Es ist das Jahr, in dem Rudi Dutschke und Ulrike Meinhof einander kennenlernen. Gerade mal zwei Jahre dauert ihre Freundschaft, doch es sind zwei Jahre, die das Gesicht des Landes verändern.
Das Interesse von Jutta Ditfurth gilt den Motiven und der Entwicklung von Ulrike Meinhof und Rudi Dutschke – und es gilt der Dynamik jener Zeit, in der beide lebten und die ihr Leben zumindest ebensosehr beeinflusste, wie „Rudi und Ulrike“ die Entwicklung dieser Zeit geprägt haben. So erzählt Jutta Ditfurth, wenn sie von der Freundschaft der beiden Meinungsführer der 68er-Bewegung erzählt, zugleich auch von der Hochzeit und dem Niedergang der „außerparlamentarischen Opposition“, der APO. Ihr Buch ist ein lebendiges Stück Zeitgeschichte, gespiegelt in den für wenige Jahre miteinander verwobenen Lebensläufen der beiden populärsten Exponenten der Studentenbewegung.
Jutta Ditfurth, geboren 1951, lebt in Frankfurt am Main. Publizistin und politische Aktivistin in neuen sozialen Bewegungen (u.a. Mitbegründerin der Grünen und Bundesvorsitzende von 1984-1988) und in der „Ökologischen Linken“, Mitglied des Frankfurter Stadtparlaments für „ÖkoLinX“. Autorin zahlreicher Bücher, u.a. „Durch unsichtbare Mauern. Wie wird so eine links?“ (2002), „Die Himmelsstürmerin“ (Roman 1998) und „Das waren die Grünen“ (2000). Im November 2007 erschien bei Econ „Ulrike Meinhof. Die Biographie“. (vol/wip)
Leseprobe:
© Droemer ©
Prolog
Ulrike Meinhof und Rudi Dutschke waren Kriegskinder im Osten Deutschlands, als das „Tausendjährige Reich“ im Mai 1945 endlich besiegt war, Ulrike war zehn, Rudi fünf Jahre alt.
Rudi Dutschke wurde am 7. März 1940 in Schönefeld geboren, einem Dorf südlich von Berlin. Er war der vierte Sohn von Elsbeth und Alfred Dutschke. Der Vater war ein nationalkonservativer Arbeiter und vom ersten Tag an Soldat im Krieg. Die Mutter, die aus einer Bauernfamilie stammte, erzog Rudi konservativ und christlich. Ab 1943 lebte die Familie in der Kreisstadt Luckenwalde. 1947 kam der Vater aus der Kriegsgefangenschaft zurück.
Für einen „Streber“ war der Schüler Rudi zu frech und zu wild, für einen „Rabauken“ zu fleißig und zu gut in der Schule. Er las viel. Der Langeweile der Kleinstadt entkam er durch seine Leidenschaft für Sport: Fußball, Hochsprung, Raufen. Er gewann sehr gern und trainierte diszipliniert. Er wollte unbedingt Sportreporter werden.
Ulrike Meinhof wurde am 7. Oktober 1934 in Oldenburg geboren. Ihr Vater Werner Meinhof war ein ehrgeiziger NS-Kunsthistoriker. 1936 wurde er Direktor des Stadtmuseums Jena. Er starb 1940. Die Mutter verliebte sich in Renate Riemeck, eine junge NS-Historikerin, der die NSDAP eine große Karriere voraussagte.
1946 traten Ingeborg Meinhof und Renate Riemeck in Oldenburg in die SPD ein und hielten enge Beziehungen zur Meinhofschen Großfamilie, die sich ihrer NS-Vergangenheit nicht stellte. 1949 starb Ingeborg Meinhof. Ulrike Meinhof war jetzt Vollwaise, Renate Riemeck wurde ihre Pflegemutter. Ulrike Meinhof machte in Weilburg/Lahn Abitur und begann 1955 in Marburg zu studieren.
Rudi Dutschke und Ulrike Meinhof politisierten sich in den fünfziger Jahren – sie in Oldenburg, Weilburg, Marburg, Wuppertal und Münster, er, ein paar Jahre später, in Luckenwalde/DDR. Sie verstanden sich zunächst als christliche Sozialisten.
Beide waren – sie 1958/59, er von 1965 bis 1968 – Mitglieder des Sozialistischen Deutschen Studentenbunds (SDS), der damaligen Studentenorganisation der SPD. Ulrike Meinhof trat 1959, nach harten Auseinandersetzungen mit der SPD um die Frage der Atomrüstung und des Umgangs mit der DDR, aus dem SDS aus und kam so ihrem Rauswurf zuvor. 1961 dann warf die SPD alle SDS-Mitglieder aus der Partei. Der nun SPDunabhängige SDS war gezwungen, sich zu emanzipieren, und konnte so 1967/68 Träger der Ereignisse werden.
Rudi Dutschke, der seit 1961 in Westberlin studierte – nicht Sport, sondern Soziologie –, trat 1965 in den SDS ein, er kam aus der Westberliner Gruppe der „Subversiven Aktion“.
Meinhof und Dutschke kämpften für eine Humanisierung, schließlich eine revolutionäre Umwälzung der gesellschaftlichen Verhältnisse in der Bundesrepublik.
Beide sahen sich in engem Bündnis mit antikolonialen Befreiungsbewegungen in Lateinamerika, Afrika und Asien. Im Zentrum stand der Widerstand gegen den Krieg in Vietnam.
Nur zwei Jahre lang, von 1967 bis 1969, verliefen die Wege von Ulrike Meinhof und Rudi Dutschke parallel; sie wurden Freunde, davon handelt diese Geschichte. Ihre Freundschaft war nur wenigen bekannt.
Wäre die RAF entstanden, wenn Benno Ohnesorg nicht ermordet worden wäre? Wäre Ulrike Meinhof Mitglied der RAF geworden, hätte ein Attentäter Rudi Dutschke nicht in den Kopf geschossen?
Aus den Niederlagen der Revolte von 1968 zogen Ulrike Meinhof und Rudi Dutschke unterschiedliche Schlussfolgerungen: Er wandte sich 1979 den Grünen zu, sie entschied sich 1970 für den bewaffneten Kampf mit der RAF. Nach dem Tod von Benno Ohnesorg 1967 und nach den lebensgefährlichen Verletzungen von Rudi Dutschke 1968 fühlten sich viele Linke in der von alten Nazis in höchsten Staatsämtern und gesellschaftlichen Positionen durchsetzten Bundesrepublik wie „Freiwild“. Sie zogen daraus den Schluss, sich zu wehren und notfalls auch zu bewaffnen.
Noch 1969 waren Meinhof und Dutschke – im Gleichklang mit der Mehrheit des Vietnamkongresses von 1968 – einig darüber, dass es richtig sei, notfalls auch mit Sabotage gegen Kriegsschiffe vorzugehen, um den Krieg in Vietnam beenden zu helfen. Über den Weg in die Illegalität dachte Rudi Dutschke 1969 nach, ein Jahr bevor Ulrike Meinhof sich dafür entschied. Noch 1977 verteidigte Dutschke militante Aktionen. Aber er hat sich seit dem Attentat auf ihn nicht mehr praktisch an illegalen Aktionen beteiligt.
Beide starben an den deutschen Verhältnissen. Ulrike Meinhof hing am Morgen des 9. Mai 1976 am Fenstergitter ihrer Gefängniszelle im Hochsicherheitstrakt Stuttgart-Stammheim; immer noch gibt es Zweifel an der Todesursache. Rudi Dutschke erlag am 24. Dezember 1979 den Spätfolgen des Attentats vom 11. April 1968.
© Droemer ©
Literaturangaben:
DITFURTH, JUTTA: Rudi und Ulrike. Geschichte einer Freundschaft. Droemer Verlag, München 2008. 240 S., 16,95 €.
Rezension
Verlag