Der Bildersturm des Professors
W.J.T. Mitchells gesammelte Beiträge in „Bildtheorie“
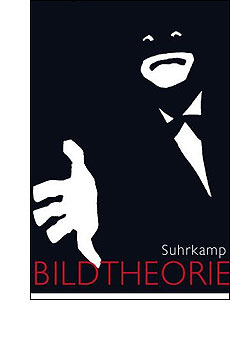 FRANKFURT AM MAIN (BLK) – Jeder sich im öffentlichen Raum bewegende Mensch werde mit einem Wust an Bildern konfrontiert. Wie solle der kritische Geist damit verfahren? Die „Frankfurter Rundschau“ („FR“) rezensiert das Buch des Bildwissenschaftlers W.J.T. Mitchell, welcher schon seit langem „eine globale Kritik der visuellen Kultur“ fordere.
FRANKFURT AM MAIN (BLK) – Jeder sich im öffentlichen Raum bewegende Mensch werde mit einem Wust an Bildern konfrontiert. Wie solle der kritische Geist damit verfahren? Die „Frankfurter Rundschau“ („FR“) rezensiert das Buch des Bildwissenschaftlers W.J.T. Mitchell, welcher schon seit langem „eine globale Kritik der visuellen Kultur“ fordere.
Bereits in der Mitte der achtziger Jahre begann Mitchell die herkömmlichen Konzepte der Bildinterpretationen öffentlich in Frage zu stellen. In seinem Grundsatzessay benannte er alle existierenden Bildformen, schreibt die „FR“. So gebe es das optische („Spiegel, Projektionen“), graphische („Gemälde, Statuen), geistige („Träume, Ideen, Erinnerungen“), perzeptuelle („auf Sinnesdaten gründend“) und das sprachliche („Metaphern, Beschreibungen“) Bild. Schon an dieser Bandbreite erkenne man Mitchells radikalen Ansatz. Für Traditionalisten gebe es ausschließlich Sprache oder Bild.
Gehörtes und Gesehenes ließen sich nicht trennen. Jeder habe bei der Betrachtung eines Bildes zuvor Gelesenes im Kopf. Umgekehrt assoziiere man Gelesenes mit bildlicher Vorstellungskraft, fährt der Rezensent der „FR“, Mario Scalla, fort. Mit seiner undogmatischen Vorgehensweise verbinde Mitchell Bilder von Velásquez (1599-1660) bis zum Mad-Magazin, um sich letztlich der Frage zu nähern: „Was wollen Bilder nun?“ (sat/wip)
Literaturangaben:
MITCHELL, W.J.T.: Bildtheorie. Übersetzt aus dem Amerikanischen von Heinz Jatho. Herausgegeben und mit einem Nachwort von Gustav Frank. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2008. 497 S., 32,80 €.
Verlage