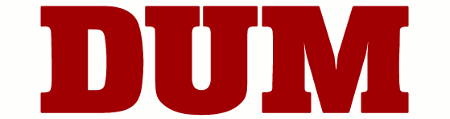Im März erscheint im Milena-Verlag Nadja Buchers Debüt-Roman "Rosa gegen den Dreck der Welt". Die Welt als Putzfrau Rosas Wille und Vorstellung. Schwarzer Humor trifft auf Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau, auf SUV-Fahrer, CO2-Emissionen und den unerfüllbaren Wunsch, an dem ganzen Dreck nicht beteiligt zu sein. Im folgenden Interview gibt Nadja Bucher Einblicke in Rosas und ihre Welt.
DUM: Was hat Rosa für ein Verhältnis zu FILZ?
Ein gutes (sie trägt Walkjanker - was definitiv nichts über ihre politische Gesinnung sagt), wenn der Filz nach Rosas Maßstäben erzeugt wurde: von Schafen aus artgerechter Haltung, pflanzlich gefärbt, in Österreich produziert.
DUM: Und wie stehst du zu FILZ?
Zuhause steh ich auf Filzpatschen. An der Wand im Vorzimmer hängt eine Filz-Pinwand. Leider finden auch Motten Filz richtig gut (haben schon mehrere Hausschuhe weggefressen). Aber richtig schlecht wird mir erst bei Verfilzungen zwischen Politik und Wirtschaft (also oft).
DUM: Rosa ist 42 und selbständige Putzfrau mit Öko-Tick. Was hat dich veranlasst, eine derartige Figur zu erfinden?
Es begann mit der Frage: Was verrät eine Wohnung über ihre BewohnerIn? Dann hab ich überlegt, wer Zutritt zu fremden Wohnungen hat -> Rauchfangkehrer, Einbrecher, Putzpersonal. Da ich keine Raubersgschicht schreiben wollte, ist nur mehr die Putzfrau übrig geblieben. (Eine weibliche Hauptfigur war von Anfang an klar.) Rosa mit ihren seltsamen Eigentümlichkeiten hat sich relativ schnell aufgedrängt - sie sollte ja jede kleinste Veränderung in der Wohnung wahrnehmen, daher musste sie auch sehr pingelig sein. Dass sie so radikal wurde, liegt wohl an ihr.
DUM: Rosa verfügt über erstaunliche Kenntnisse alles Schädliche betreffend. Wie bist du bei der Recherche vorgegangen?
Ich dachte mit den Bereichen Reinigungsmittel, Kosmetik, Lebensmittel wäre die Sache erledigt. Dafür hab ich im Supermarkt allerhand Inhaltsstoffe abgeschrieben (Putzmittel, Pflegeprodukte, Fertigmenüs). Aber Rosa haben immer mehr Dinge aufgeregt, daher wurden zahlreiche Besuche in der städtischen Bücherei notwendig: Toxikologie der Nahrungsmittel, Allergene in Kosmetika, Plastic Planet, Abhandlungen über die Lügen der Auto-, Atomstrom-, Energieindustrie, Anbau- und Produktionsmethoden der Textilindustrie und natürlich die Recherchedokus von Leo Hickman "Und tschüss" und "Fast nackt". Ich hab nervige Mails an die Wiener Linien, ÖBB, Liftfirmen, Wien Energie bezüglich Energieverbrauch geschrieben. Ach ja, Ö1-Hören und Wikipedia haben auch geholfen.
DUM: Und die Putzkünste? Harte Schule aus dem Elternhaus, WG-Erfahrungen, persönliche Leidenschaft oder reine Fiktion?
Zur Rohfassung von Rosas Putzszenen haben böse Zungen Glaubwürdigkeitszweifel angemeldet. Meine Antwort darauf: "also ich hab mir das so vorgestellt". Ja, eher reine Fiktion - hab dann aber doch Recherchearbeiten mit Essig und Altpapier auf Glasscheiben gemacht. (Wie so oft war die Phantasie erhebender als die Wirklichkeit.)
DUM: "Rosa gegen den Dreck der Welt" ist dein erster Langtext. Welche Bedingungen, Rituale brauchst du, um schreiben zu können?
Oje, jetzt wird's intim. 1.) gesicherte finanzielle Situation (sehr schwierig!), 2.) den ganzen Tag Zeit (auch nicht einfacher), 3.) eine leere Wohnung (d.h. Freund muss raus), 4.) keine Ablenkungen (Handy aus, Radio aus, E-Mail aus), 5.) ganz ganz bequeme Kleidung (ich sag nur, nicht gesellschaftsfähiger Anblick).
DUM: Wie diszipliniert bist du?
Naja, ich ess fast immer auf!
DUM: Rosa sucht sich ihre KundInnen sorgfältig aus. Sie hat offenbar einen Hang zu skurrilen Personen: Die eine mit Waschzwang und Zierkissenwahn, der andere ein Modelleisenbahnen- und Zinnsoldatensammler. Klingt alles reichlich verrückt oder ist die Normalität so? Bzw. woher kommen die Impulse für die originellen Nebenfiguren?
Von immer und überall. Verrückt, oder?
DUM: Rosa beseitigt Spuren in den Wohnungen ihrer AuftraggeberInnen, hat Rosa in deinem Leben Spuren hinterlassen?
Rosa strebt im Grunde Perfektion an und scheitert kontinuierlich. Das hat mich extrem beruhigt.
DUM: Wer wäre für dich die Idealbesetzung bei einer Rosa-Verfilmung?
Ein gänzlich unbekanntes Gesicht - weil Isabelle Huppert hat schon Klavier gespielt.
DUM: Gibt es bereits Pläne für neue Projekte? Theater, Poetry Slam, Lesebühne?
Ein, zwei Themen gären bereits, aber brauchen noch Zeit.
DCA möchte ich so bald wie möglich fortsetzen, da Schreiben unter Zeitdruck immer inspirierend ist, eben Arschtritt.
Für Slams fallen seit längerem keine Kurztexte an - anscheinend ärgere ich mich über meine Umwelt weniger als früher. (Ein Nebeneffekt von Rosa?)
DUM: Und zum Schluss: Schokolade bringt Rosa in Bedrängnis, wie hältst du es mit dem Schokokonsum?
Je teurer desto lieber.
DUM: Vielen Dank und dir viel Erfolg mit Rosa.
ARGUMENTE FÜR HATSCHEK
(Romanauszug)
Rosa fürchtete Hatscheks Bild korrigieren zu müssen. Obwohl die Wohnung eindeutig einer intelligenten Person gehören musste. Was bereits aus den hier nicht vorhandenen Warenlagern zu schließen war. Speisevorräte, wie sie bei Herrn Novotny vorzufinden waren, der Fertiggerichte mit Verfallsdaten jenseits der zweitausendeinhunderter Grenze in seinen Küchenkästen stapelte, fehlten bei Hatschek gänzlich. Herr Novotny legitimierte sein bunkerhaftes Wesen mit vordergründigen Preisvorteilen. Aber Rosa kannte diese kleinlichen Seelen, die sich hinter rationalen Begründungen ängstigten, um sich scheinbare Sicherheiten zu konstruieren. Und wollte Hatschek nicht unter ihnen wissen.
Hatscheks Andersartigkeit wurde selbst von den fehlenden Zimmerpflanzen bewiesen. Bei Topfpflanzen wich Rosas Gesichtsfarbe spontan. Sie versuchte schon lange den historischen Augenblick zu ergründen, als Grünpflanzen samt Erde menschliche Wohnräume besiedelten. Irgendein auslösendes Moment musste das doch gehabt haben, dachte Rosa, konnte jedoch keines eruieren. Ästhetische Gründe waren daran sicherlich nicht beteiligt. In den wenigsten Fällen ist die Pflanze nämlich in ein geschmackvolles Umfeld gesetzt. Tontöpfe bilden unansehnliche Kalkablagerungen, wohingegen emaillierte Töpfe nur in grässlichen Farb-, Muster- und Formgebungen zu erstehen waren. Blumenerde ist schieres Gift, angereichert mit chemischem Dünger und Torf, dessen industrielle Ausbeutung europäische Moore, die sich über Jahrtausende entwickelten, zum Verschwinden bringt. Die Blätter werden vollgepumpt mit Schildlauspräparaten damit sie halbwegs schimmern. Topfpflanzen stehen immer im Weg. Entweder vor dem Fenster, wo sie auch noch das Zimmer verdunkeln, oder in irgendeinem Winkel, aus dem sie sich überfallsartig vorneigen, sobald jemand vorübergehen möchte. Darüber hinaus werden Zimmerpflanzen rasch von grauen Staubschichten überzogen, die Nase und Schleimhäute reizen. Oftmals sogar setzen Zierpflanzen beim Stoffwechsel giftige Substanzen frei. Unlängst hatte Rosa noch einen Kunden, Herrn Marlois, der konsequenter Pflanzenliebhaber war. Er lebte alleine in einer geräumigen, hellen Wohnung in Innenstadtnähe, war Frühpensionist, aber erfreute sich allerbester Gesundheit. Herr Marlois kümmerte sich liebevoll um seine zahlreichen Zimmerpflanzen. Jede stand oder hing an einem für sie optimalen Platz. Sonnig, schattig, halbschattig, kühl, warm, tropisch-feucht. Alle Klimazonen ahmte Herr Marlois mit Lampen und Luftbefeuchtungsanlagen nach. In der windstillen Ecke seiner Küche befand sich eine riesige Spathiphyllum, die prächtig gedeihte. Sie wuchs zu solch gigantischem Ausmaß an, dass der Küchentisch, über den sie partiell hing, nur mehr bedingt nutzbar war. Herr Marlois erlaubte niemanden seine Pflanzen zu verrücken. Mühsam für Rosa, unangenehm für etwaige Gäste, denen die Spathiphyllum penetrant in den Nacken hing. Bedeckte die Pflanze anfangs zwei Sessel und einen Teil der Tischplatte, konnte bald nur mehr an einer Ecke des Tisches Platz genommen werden. Herrn Marlois absolutes Lieblingsstück war aber seine hängende Prachtlilie, Gloriosa superba. Die streckte ihre langen Kletterarme von der Wohnzimmerdecke und dominierte auch ohne rot-orange Blüten (die ein Mal im Jahr für drei Tage zu erleben waren) das Erscheinungsbild des Raumes. Herr Marlois besprühte die Blätter seines Lieblings täglich, wusste genauestens über dessen Nährstoffbedarf Bescheid und achtete auf Licht und Temperaturverhältnisse. Alles wusste Herr Marlois über die Prachtlilie, außer, dass sie bei der Photosynthese eine spezielle, geruchlose Säure erzeugte, die beständig von den Blattspitzen an die Raumluft abgegeben wurde. Herr Marlois nahm die Stoffwechselerzeugnisse seiner Pflanze mit der Atemluft ein, über Jahre hinweg. Lange merkte er nichts davon. Irgendwann klagte er über Kopfschmerzen. Er machte Wetterumschwünge, übermäßigen Alkoholkonsum, seine schlechter werdenden Augen dafür verantwortlich. Niemals hätte er seine hängende Gloriosa superba verdächtigt. Nicht einmal als sich zu den immer stärkeren Kopfschmerzen Schwindel, Herzrhythmus- und Gleichgewichtsstörungen schlugen. Selbst als er eines Tages tot unter der Pflanze lag und ein Arzt unauffälligen Gehirnschlag attestierte, fiel auf die Prachtlilie kein Argwohn. An jenem Tag übrigens, als Herr Marlois im Wohnzimmer lag, konnte der Arzt nicht einmal mehr den Totenschein auf dem Küchentisch ausstellen, so überwucherte ihn die Spathiphyllum.
Hatschek war da eben anders. Auch das gepflegte, durchgängige Parkett ihrer Wohnung verriet dies. Wenn Rosa im Vergleich dazu an das kinderlose Ehepaar Pospischil dachte, von denen sie sich erst kürzlich getrennt hatte. Herrn Pospischil hing über seine Hühnerbrust die sich zum Schmerbauch aufschwang eine charakteristische Goldkette. Frau Pospischil trug ein breites Becken in unübersehbaren Leggins. Die beiden lebten in einer Wohnung, die flächendeckend mit Spannteppichen in unterschiedlichen Farben ausgelegt war. Im Bad ein hellblaues Exemplar, das WC war rot, das Vorzimmer braun, Wohnzimmer beige, der Küchenboden mit strapazierfähigem Muster. Alles reinster Irrsinn. Die Optik, das Raumklima, der Zustand. Dem Teppich waren seine Erfahrungen wie Jahresringe anzusehen. Brandflecken dort, wo im Wohnzimmer der Weihnachtsbaum stürzte. Abrieb dort, wo im Vorzimmer die meisten Besucher kamen und gingen. Essenreste dort, wo in der Küche gekocht wurde. Schimmelpilz dort, wo im Bad die Wanne überlief. Der Spannteppich wurde bei Herrn und Frau Pospischil zum hygienischen Terrorakt. Dem wirkte Rosa jede Woche mit Nassreinigung entgegen. Sie rutschte auf Knien durch die Wohnung, ihren Holzkübel neben sich und schrubbte mit einer harten Schweineborstenholzbürste Pflanzenseife in den Teppich. Horrender Aufwand, mäßiger Erfolg. Von Woche zu Woche verschob Rosa die Auflösung ihrer Arbeitsvereinbarung. Erst als Kinderersatz Lucky, ein unkupierter Bobtail, einzog und ziemlich lang brauchte stubenrein zu werden, ging Rosa.
Ja, selbst Haustiere hatte Hatschek nicht. Das allein schon Beweis für geistige Gesundheit. Sich Tiere in den eigenen Wohnbereich zu sperren, war die absurdeste Idee von allen, fand Rosa. Haare, Kot, Körperausdünstungen, Straßenschmutz, Flöhe, Zecken, Würmer, Milben, biologische Abhandlungen unbenennbarer Parasiten holten sich Leute freiwillig in ihre Wohnungen. Obwohl doch wirklich hinlänglich bekannt sein musste, dass Tierhaare heftigste Reaktionen bei Allergikern auslösten.
Den Pospischils freilich war das egal. Die schafften sich Lucky an, der anfangs kurze Haare hatte und relativ pflegeleicht war. Doch wuchs dem Hund bald ein schwarz-weißes Fell von zehn Zentimetern Länge. Seine Haare waren von solcher Feinheit, dass sie sich über die gesamte Wohnung verteilten, überall anlegten und selbst mit dem Klopfstaubsauger auf stärkster Stufe nicht von den Möbeln zu entfernen waren. Das Tier wuchs sich zu einem sabbernden Zottelbären aus, der seinen kotverschmierten Anus am Wohnzimmerteppich abwischte und aus dem Mund stank. Als Lucky unter die Bettdecke seines Besitzers schlüpfte und Herr Pospischil gerührt bekannt gab "das is meine größte Freud, wenn er bei mir im Bett übernachtet", verkündete Rosa ihren Abschied. Sie nahm fortan keine Aufträge bei Tierbesitzern an, egal ob es sich bei deren Mitbewohnern um Wellensittiche, Fische oder Echsen handeln sollte. Obwohl gerade Tierbesitzer vermehrt Anfragen an sie richteten. Denen war die Schmutzproduktion ihrer Lieblinge scheinbar auch zu viel. Rosa gab gerne Kontaktdaten für Spezialeinheiten der chemischen Reinigung weiter, die mit Schutzanzügen und Atemmasken anrückten. Chemie war in diesen Fällen gerade recht. Sie lehnte aufgrund geistiger Inkompatibilität ab. Bei jemandem, der sich unhygienische Bestien in seinem Lebensraum hielt, der stinkende Nahrungsmittelabfälle aus Plastik- oder Aluminiumverpackungen durchwegs aus Massentierhaltung von Konzernen wie Kraft oder Unilever meist in der Küche neben der eigenen Essstelle verfütterte, konnte Rosa nicht putzen. Das wäre Selbstverleumdung und Vergeudung ihrer Fähigkeiten gewesen.
Aber auch dieser Unart gab sich Hatschek nicht hin. Genau deshalb, weil Hatscheks Wohnung weder Zimmerpflanzen noch Teppiche, Vorhänge, Zierkissen oder Haustiere hatte, war Rosa ihr zugetan. Weil Hatscheks Wohnung nicht so war, wie die anderer Kundinnen, stellte sich Rosa Hatschek auch anders vor. Weil sie Hatschek nicht kannte, machte sie sich ein Bild von ihr. Aber dreckiges Geschirr in der Abwasch passte nicht in dieses Bild.
Als Rosa weiterhin über Hatschek, Teller und Haustiere nachdachte, fiel ihr erneut Ludmilla ein. Sie hatte ihr im Krankenhaus von jemandem erzählt, der sich Vogelspinnen hielt. Ludmilla war überhaupt ein Pool an grauenvollen Geschichten gewesen, denen Rosa fasziniert zuhörte. Als Putzfrau des Pavillon 23, Station für forensische Sozialpsychiatrie, stand sie eines Tages mit Wischmop und in gelben Plastikschlapfen in Rosas Zimmer. Ludmilla sagte "hallo" und wischte das Linoleum. Das tat sie konzentriert und mit einer Ernsthaftigkeit, als verrichtete sie Messdienst. Nachdem Ludmilla von links beim Fenster nach rechts zur Tür gewischt hatte, sagte sie "baba" und schloss die Tür von außen. Am nächsten Tag kam sie wieder und absolvierte das gleiche Prozedere. Am dritten Tag entspann sich ein Gespräch über Putzmittel, das bald von schaurigen Geschichten über Leute, bei denen Ludmilla putzte, abgelöst wurde. Sie war zwar bei der Reinigungsfirma für Wiener Krankenanstalten angestellt, doch nahm sie nebenbei noch weitere Aufträge an. "Na sicher, alles in Pfusch", klärte sie Rosa über die finanziellen Vorteile ihrer Zusatzbeschäftigung auf. Dabei zog sie das i von sicher so lang, als wollte sie daraus eine soziale Hängematte bauen. Auch die stete Nachfrage und relativ gute Bezahlung verriet Ludmilla ohne Angst vor Konkurrenz. Es dauerte nicht lange, wurden Ludmillas Besuche zu Rosas Höhepunkt im Spitalsalltag. Sie liebte Ludmillas Geschichten, ihren groben Akzent und ihren menschenverachtenden Schwung in jeder Bewegung. Menschen waren für Ludmilla nur verursachendes Übel. Auf die Gegenstände kam es an, die galt es zu schützen und zu bewahren. "Stell da vor", begann sie jede ihrer Geschichten, lehnte sich dabei an den Stiel ihres Wischmops, stemmte eine Hand in die Seite und stellte ein Bein über das andere. Regelmäßig glitt dabei ihr Schlapfen vom Fuß. Das Linoleum um sie herum glänzte feucht. "Stell da vor", sagte Ludmilla. Rosa saß erwartungsvoll auf ihrem Bett, die Beine baumelten seitlich herunter. Aufmerksam wie ein Kind im Zuckerlgeschäft schaute sie in Ludmillas dunkle Augen, die von schwarzen Rändern untermalt wurden. "Stell da vor", begann sie auch die Geschichte von Herrn Linnhardt. Der war ein alleinstehender Mann um die fünfunddreißig. Klein, untersetzt und haarig. Dunkelhaarig mit fast kahlem Kopf und starker Körperbehaarung, die schon nach der Glatze im Nacken begann, den Rücken bedeckte, bei Brust und Bauch nicht stoppte, selbst an den Fingern nicht fehlte und auch auf den großen Zehen anzutreffen war. Lediglich Handinnenseiten und Fußsohlen waren unbehaart. Weshalb Ludmilla Herrn Linnhardts Körper derart detailliert schildern konnte, lag an dessen Vorliebe seine Wohnung zu überheizen und sich in selbiger mit Sandalen, Shorts und Unterhemd zu tummeln. Herr Linnhardt heizte seine Wohnung nicht zu seinem eigenen Vergnügen. Die fünfunddreißig Grad Raumtemperatur hielt er für seine fünfzehn Vogelspinnen konstant. Die konnten sich erst bei wohliger Wärme so richtig frei in der Wohnung bewegen. Meistens bewegten sie sich trotzdem nicht viel, sondern saßen oft stunden- und tagelang an ein und demselben Fleck. An der Decke, im Terrarium, im Ärmel von Herrn Linnhardts Jackett oder in seinen Schlüpfern. Ludmilla grauste unendlich vor diesen Viechern, doch brauchte sie zu dieser Zeit Geld. Viel Geld für ihre Familie in Bosnien. Und Herr Linnhardt war bereit drei Mal so viel wie üblich zu zahlen, sonst hätte sich niemals Reinigungspersonal in seine Spinnengrube verirrt. Das lustige an Herrn Linnhardt und seinen Vogelspinnen, meinte Ludmilla, war deren Ähnlichkeit. "Musst da vorstellen", variierte Ludmilla manchmal ihre Einleitung, "alle schwarz und lauter Haare". Die Tiere sahen aus wie Linnhardts missratene kleine Nachkommen, denen er nur seine Behaarung vererbt hatte. Mit Vogelspinnen ist es allerdings so, dass sie sich in regelmäßigen Abständen, eigentlich ziemlich häufig, häuten. Was aber anders als bei Schlangen verläuft. Vogelspinnen verpulverisieren ihre oberste Hautschicht. Das führte in der vierzig Quadratmeter-Wohnung bei fünfzehn Spinnen und Zentralheizung im Dauerbetrieb zu einer ziemlich heftigen Staubbelastung. "Stell da vor", sagte Ludmilla, Herr Linnhardt von teigigem Wesen eines Computerkoordinators war Stauballergiker. "Musst da vorstellen", immer nur rote Augen, rote Nase, immer nur niesen und Taschentücher. Seine eigene Wohnung hätte für ihn zum Sperrgebiet erklärt werden müssen. Aber er nahm alle Asthmaanfälle dankbar hin, nur um mit seinen haarigen Ablegern zu sein. "Stell da vor, so ein Idiot, na sicher hearst", schloss Ludmilla die meisten ihrer Erzählungen, wobei das i von sicher zur Garantie wurde, selbst niemals einer solchen Dummheit verfallen zu können.
< zurück zu Heft 57