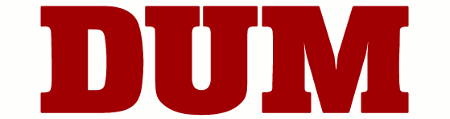Unter sizilianischer Sonne hat Wolfgang Kühn den am anderen Ende Italiens (Triest) angesiedelten, beeindruckenden Roman von Christian Klinger gelesen. Für das Interview mit dem mehrfachen DUM-Gastautor (Ausgaben # 42 / 57 / 66 / 71) wurde die pandemiesichere Variante des E-Mail-Verkehrs gewählt.
DUM: In einer Zeit, in der immer mehr AutorInnen auf die vermeintliche Cashcow "Krimi" aufspringen, gehst Du den umgekehrten Weg. Wieso nach den Marco-Martin-Krimis plötzlich eine Familiensaga, ein "Epochenroman", wie der Buchdeckel verrät?
Erstens glaube ich, dass der Krimi als Garant für Erfolg und Reichtum überbewertet ist. Hinter dem aktuellen Roman standen keine strategischen Entscheidungen - es scheint viel eher so, als ob das Thema mich gefunden hat anstelle umgekehrt (mehr dazu unten).
In Deiner Biografie liest man: "Seit 2017 Zweitwohnsitz in Triest." Das ewige Fragespiel mit der Henne und dem Ei - bist Du der Romanidee wegen nach Triest gezogen oder ist Dir in Triest die Idee zum Roman gekommen?
Triest ist meine "Spätliebe" in Italien. Ich war mein ganzes Leben noch nie in Triest, bis ich vor wenigen Jahren erstmalig im Zuge eines Sommerurlaubs in Grado einen Ausflug dorthin unternommen habe - und von der Stadt enttäuscht war. Wir haben dann jedoch Triest als optimalen Urlaubsort im Winter für uns entdeckt. Es gibt nichts Schöneres, als an einem klaren Wintertag im Jänner die Rive entlangzugehen oder an einem milden Februartag in Barcola am Meer zu spazieren und die ersten wärmenden Sonnenstrahlen zu genießen. Da trifft man dann auch schon die ersten Menschen, die mit Liegestuhl ein erstes Sonnenbad nehmen. Mit zunehmender Auseinandersetzung mit Triest und dessen Geschichte kam auch der Wunsch, etwas über die Stadt zu schreiben. Parallel dazu auch jener, dort eine Bleibe zu haben.
Wie bist Du auf die Geschichte von Giuseppe "Pino" Robusti gestoßen?
Mein Lieblingsbuch über Triest stammt aus der Feder von Mauro Covacich (Triest verkehrt). In einem Kapitel über die Piazza Oberdan berichtet er auch über Pino Robusti, dessen Vermächtnis die zwei Briefe sind, die er knapp vor seiner Ermordung geschrieben hat. Ich besuchte aber schon bei der Recherche für "Blutschuld" die Risiera di San Sabba (KZ), wo es einen Videoschirm zu Pino gibt. Ich begann mich für seine Geschichte zu interessieren und wollte weitergehende Informationen über ihn, am besten eine Biografie, lesen und war sehr erstaunt, dass ich dazu nichts finden konnte. Ich fand es schade, dass die Nachwelt diesen jungen Mann, der auf seinem Foto so viel Zuversicht ausstrahlt, nicht als Person kennenlernen kann, daher wollte ich ihm eine Stimme geben, ihn als Menschen und nicht nur als Opfer des Faschismus zeigen.
Wie lange hast Du an diesem Buch geschrieben, inklusive Recherche?
Fast drei Jahre. Ich habe parallel zur Quellenforschung schon zu schreiben begonnen und mir war bald klar, dass es nicht nur um Pino allein gehen wird, sondern dass es zur Darstellung seiner Geschichte auch der Geschichte seines Vaters und auch dessen Vaters bedarf, was aber dann rein fiktional wurde. So erstreckt sich der Handlungsbogen von den letzten Tagen der Habsburgermonarchie bis in die Zeit der Naziokkupation Triests. Eine Zeit vieler Umstürze und Veränderungen und auch der persönlichen Beschränkungen durch diktatorische Regime.
Was war für Dich das Schwierigste an diesem Roman?
Um ganz ehrlich zu sein: Ich dachte mehrmals, ich werde an diesem Projekt scheitern. Es war so schwierig, aus dem wenigen, was es über Pino gibt, seine wahren Charakterzüge abzuschätzen. Oftmals musste ich Dinge, die ich bereits ansatzweise entwickelt hatte, weglassen, weil ich für mich keine befriedigende Erklärung finden konnte und nicht den Mut hatte, ihm Eigenschaften, die nicht ersichtlich sind, zuzumessen.
Sehr spannend in dem Buch sind unter anderem die vielen Zeitensprünge, die den Leser fordern, aber nicht überfordern. Hattest Du da manchmal Angst, dass es zu viel sein könnte?
Die Idee dahinter war, dass sich die Geschichten von Vater und Sohn über zwei Zeitachsen langsam nähern (von vorne und hinten), ab der Mitte verläuft die Erzählung dann ja auch mehr oder weniger chronologisch linear. Das war nicht immer ganz leicht einzuhalten. Aber ich habe mich wie ein Archäologe durch die verschiedenen Schichten zu Pino vorgegraben, das tun die LeserInnen jetzt auch.
In der Danksagung am Ende des Romans werden vier bekannte KrimiautorInnen erwähnt. Warum hast Du bei Deinem Buch, das ja kein Krimi ist, ausgerechnet bei AutorInnen dieses Genres Ratschläge und Unterstützung gesucht?
Edith Kneifl und Andi Pittler haben viele historische Krimis publiziert, Stefan Slupetzky hat beim vorletzten Lemming auch einen Ausflug in dieses Genre gemacht (und auch einen wunderschönen Familienroman verfasst) und Daniela Larcher feiert als Alex Beer aktuell unzählige Erfolge mit ihren historischen Krimis. Aber Daniela hat mir vor allem bei der strategischen Vermarktung sehr geholfen. Viele Ratschläge bezogen sich nicht konkret auf dieses Buch, sondern auf allgemeine Tipps beim Recherchieren und Schreiben historischer Stoffe.
Gibt es Ideen / Pläne, dass "Die Liebenden von der Piazza Oberdan" auch auf Italienisch erscheint?
Weder der Verlag noch ich wären dem abgeneigt; aber derzeit gibt es noch keine konkreten Anfragen italienischer Verlage dazu. Es gibt jedoch von einigen Personen aus Triest die Idee, eine Präsentation des Buchs auf Deutsch zu machen. Wegen der derzeitigen COVID-Situation da wie dort haben wir dieses Vorhaben aber einmal auf das Frühjahr verschoben.
Was hat Triest, abgesehen vom Meerzugang, was Wien nicht hat? Was umgekehrt?
Der Reiseführer würde hier antworten: den größten zum Meer hin offenen Platz. Das ist eigentlich ein Paradoxon, denn in Triest ist alles eine Spur kleiner dimensioniert als in Wien. Man kann fast alles gut zu Fuß abwickeln. Triest ist wie eine Großstadt für die Westentasche. Man geht über die Piazza dell'Unità d'Italia mit den polierten Geschäftsportalen und keine zehn Minuten zu Fuß ist man beim Ospedale Maggiore, wo ganz andere Geschäfte sind, aber auch ein anderes Publikum verkehrt. Wien hat eine U-Bahn und weit mehr Platz auf den Straßen, und ja, sogar, wenn man in der Josefstadt wohnt, auch mehr Parkplätze. Dafür bekommt man in Wien nirgends einen Aperol Sprizz wie in der Gran Malabar oder im Caffè degli Specchi.
Gibt es schon Pläne für ein nächstes Buch? Wenn ja, wieder ein Roman oder geht es zurück ins Krimi-Genre?
Zwischen der Fertigstellung und Veröffentlichung der "Liebenden" habe ich einen Thriller geschrieben, der im Frühjahr bei Ueberreuter erscheinen soll. Eine neue Figur und auch anders zu dem, was ich bislang gemacht habe. Die Hauptfigur ist ein empathiebefreiter Anwalt, der in eine Mordserie verwickelt ist. Sex and Crime, um es kurz zu fassen. Aktuell bin ich aber schreibend wieder ins Triest der Habsburgermonarchie zurückgekehrt. Es wird mein erster historischer Krimi mit Ispettore Gaetano Lamprecht als Ermittler.
Vielen Dank für das Interview und alles Gute!
< zurück