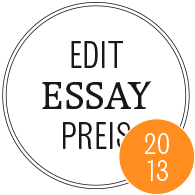Denis Scheck
Laudatio zur Verleihung des Calwer Hermann-Hesse-Preises an Edit
Liebe Hermann-Hesse-Preisträger aus der Edit-Redaktion, meine sehr verehrten Damen und Herren,
“aus dem Chaos neuer Namen, neuer Sprachen, neuer Grammatiken und Kunstforderungen” meldete sich Hermann Hesse im April 1920 in “Vivos voco” zu Wort. Hand aufs Herz, die allermeisten von uns wissen heute nicht mehr, was “Vivos voco” war, wofür diese Zeitschrift einmal stand, welche Hoffnungen 1919 zu ihrer Gründung, weiche okönomischen Zwänge oder ernüchternden Erfahrungen mit den Beiträgern 1921 zu ihrer Einstellung führten, welche Hochzeiten, Mittelmaßphasen und Tiefpunkte einzelne Ausgaben markierten, welchen Kurs sie hielt oder zu halten versuchte, welche Talente sie entdeckte und förderte, welchen Autoren sie eher zu schaden trachtete, schließlich auch, weiche innerredaktionellen Kontroversen, Debatten und Rankünen sich bei “Vivos voco” abspielten. Selbst der Name der monatlich erscheinenden Zeitschrift, die Hesse zusammen mit Richard Woltereck aus der Taufe gehoben hatte, muß heute obskur erscheinen, weil die selbstverständliche und mühelose Beherrschung von Latein unter Gebildeten nicht mehr vorausgesetzt werden kann. Keine Angst, ich will hier kein memento mori für Zeitschriftenherausgeber malen, aber solche Timetunnel-Experimente sind notwenig, um sich Klarheit über die Frage zu verschaffen, was eine Literaturzeitschrift im lnternetzeitalter leisten kann und soll.
An dieser Stelle mag ein weiterer kleiner Exkurs reizvoll sein, eine zweite kleine Zeitreise, diesmal in eine zukünftige Welt, in der das Englische seine Rolle als neue lingua franca womöglich an eine andere Sprache abgegeben hat, ans Chinesische, Portugiesische oder ans Urdu vielleicht, und der Name der heute zu preisenden Zeitschrift somit nicht mehr den selbstverständlichen Doppelklang von “Edit” und “ädit” auslöste. “Edit”, “ädit” wird jedem deutschen Literaturinteressierten in schöner Janusköpfigkeit zum Prüfstein seiner inneren Amerikanisierung. Will man in intimer Vornamenvertrautheit und so ganz ohne Sinn von der deutschen Edit sprechen oder lieber doch von “ädit”, was die dort sorgfältig und klug betriebenen Tätigkeiten des Lektorierens, Herausgebens und Veröffentlichens klar benennt, allerdings um den Preis, daß der die Zeitschrift so Bezeichnende sich im sprachlichen Gewand eines jener”content manager” präsentiert, die im Moment in deutschen Verlagshäusern den “turnaround” in Richtung 10-Prozent-Renditen versuchen und dabei aufs Outsourcen und Downsizen nicht verzichten können? Good luck, möchte man da sagen.
Rasen wir auf der Zeitautobahn an der Ausfahrt Gegenwart vorbei gleich noch einmal zurück in die Vergangenheit von “Vivos voco”, finden wir eine weitere verblüffende Parallele zur “Edit” von heute. “Vivos voco” gab als Erscheinungsorte nämlich Bern und Leipzig an, die Stadt der “Edit” also, ädittown: hier hat 1993 die Schriftstellerin Katrin Dorn jenes Forum der deutschen Gegenwartsliteratur gegründet, das heute mit dem Hermann Hesse Preis ausgezeichnet wird. Versuchen wir einmal das, was im Film eine Überblendung heißt, legen wir zwei Bilder übereinander und lassen den eingangs zitierten Hesse in seiner selbstgegründeten Zeitschrift 1920 “aus dem Chaos neuer Namen, neuer Sprachen, neuer Grammatiken und Kunstforderungen” sprechen
“Hier ist alles Stammeln”, schreibt Hesse, “alles Auflösung und Neubeginn, es gibt keine Formen und Grenzen mehr, daher ist es für den Bürger einfacher, über dies alles zu lachen und es verrückt zu finden. Diese jungen Dichtungen mit den alten zu vergleichen ist unsinnig, von ihrer wilden Sprache Maß und Adel verlangen, ist lächerlich. Möglich, daß alle diese Werke wieder untergehen, daß nicht eines davon diese Zeit überlebt. Es handelt sich aber nicht um Werke, sondern darum, daß sie der Ausdruck unserer Jugend sind, einer Jugend, die aus allen Träumen und Ahnungslosigkeiten ihres ersten Frühlings in den Krieg gerissen wurde, trunken von Angst, trunken von Blut, wild vor dem schauerlichen Eingesperrtsein in Dienst und sinnloses Tun, Tag und Nacht dem Tod gegenüber, dem Schmutz gegenüber, dem Ekel gegenüber, vom Unteroffizier und Leutnant gar nicht zu reden.”
Ließe sich hieraus, aus Hesses Worten, etwa auch die Stimme Katrin Dorns von 1993 hören? Sicher nicht, was Krieg, Schützengraben und Bluttrunkenheit angeht. Aber lag nicht eben doch eine Phase “schauerlichen Eingesperrtseins in Dienst und sinnloses Tun” hinter vielen der späteren Editautoren, jedenfalls soweit sie aus der ehemaligen DDR stammten? Wiewohl man sich hüten sollte, im Abstand von weniger als mindestens 20, 30 Jahren mit der schönen Epochengewißheit des Literaturhistorikers aufzutreten, darf konstatiert werden, daß die Folgen des Epochenwandels von 1989 bislang keine weitgehend bestimmende Stilrichtung hervorriefen, keine an Durchschlagskraft und Attraktion dem Phänomen Expressionismus vergleichbare Bewegung, die Hesse 1920 bemerkenswert luzide in jenem Vivos voco Artikel über einige neue Bücher von Autoren wie Richard Huelsenbeck zu charakterisieren versuchte. Was aber dann?
Eine Vielzahl unterschiedlichster Schreibweisen, claims im literarischen Feld, die zu vermessen sich seit 1993 die im Rotationsprinzip wechselnden Herausgeber der “Edit” nach Katrin Dorn unternahmen – Jana Hensel und Jo Lendle, Jörg Schieke, Tobias Hülswitt, Miriam Bosse und Tom Kraushaar und seit neuestem Jaroslaw Piwowarski und Franziska Gerstenberg. Was hier gelang, ist im Grunde nur zu würdigen, wenn man nach der Zeitreise die Gegenprobe der Alternativ- oder Parallelwelt macht. wie sähe die literarische Landschaft, das literarische Leben aus ohne “Edit” oder mit einer anderen “Edit”, einer Zeitschrift also, die sich statt des luftigen Gewands der für alles und jeden offenen “Entdeckerzeitschrift” für neue deutsche Literatur in ein engeres programmatisches Korsett gezwängt hätte? Die sich etwa ausschließlich als Organ der im Leipziger Literaturinstitut Studierenden verstanden hätte? Oder als Speerspitze der Popliteratur, was immer das sein mag? Als Plattform verkaufsträchtiger neuer deutscher Erzählerseligkeit, als Lanze ostdeutscher Ressentimentnostalgie oder als Forum westdeutscher Kultur-Conquistadores? Ja, schlimmste aller Möglichkeiten, als nach oben und unten hermetisch abgeschottetes “Generationenblättle” – die bei dieser Schreckvorstellung evozierten Emotionen erlauben einen Rückfall ins Schwäbisch-Konkrete -, als “Generationenblättle” also, das ein langweiliges Wir-gegen-die-Spiel propagiert, junge Hüpfer gegen alte Säcke, und in kaum verhülltem Sozialdarwinismus Ausgrenzung qua Geburtsjahr vornimmt.
Dies alles ist Edit nicht und drohte es nie zu werden. Statt dessen hat man sich Arno Schmidts Diktum aus den 50er Jahren zu eigen gemacht, wonach es gleichgültig sei, ob ein Dichter Stalin oder die Jungfrau Maria besinge, Hauptsache, es werde gut gesungen. Natürlich liegt bei einer Zeitschrift, die Neues entdecken will, der Schwerpunkt auf jungen Autoren. Doch wenn man auch nur einige wenige der Namen Revue passieren läßt, die in 28 Ausgaben von Edit präsentiert wurden – Marcel Beyer und Sibylle Berg etwa, Antje Ravic Strubel und Jenny Erpenbeck, Julia Franck und Franzobel, Adolf Endler, Elke Naters und Kathrin Röggla, Julia Schoch und Raphaei Urweider, Leander Scholz und Ze de Rock -, dann wird deutlich, daß hier ein vor jedem beliebigen Ausschlußkriterium wie Alter, Nationalität oder einer einäugigen Gruppenästhetik gefeiter Pluralismus zum Ausdruck kommt, den es so
in der Landschaft der deutschsprachigen literarischen Zeitschriften noch nie gab. Der Literaturkritiker Michael Braun brachte dies einmal auf die Formel: “Über beide Schriftstellertypen in der jungen Literatur: den formulierungsflinken, kommunikationshungrigen und modebewussten Pop-Autor einerseits, und den sich unablässig zergrübelnden, an der Grenze zum Wahrnehmungsverlust entlangschreibenden Sprachskeptiker andererseits erhalten wir in der Leipziger Literaturzeitschrift EDIT zuverlässige Auskunft. … Über den Stolz und die Fron, ein Schriftsteller deutscher Sprache zu sein, wird wohl nirgendwo so produktiv gestritten wie in der EDIT. “
Möglich gemacht haben dies der Literaturverein Edit mit seinen etwa 50 fördernden Mitgliedern, auch die wichtigen Zuwendungen des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst sowie die des Kulturamtes der Stadt Leipzig, möglich gemacht hat es aber vor allem das Engagement einer Herausgeberriege, die ihr eigenes Leben mit Literatur verbunden haben und dies mit einer Unbedingtheit, die der positiven Obsession angehender Fußballprofis, Berufsmusiker oder Schauspieler in nichts nachsteht.
Es ist dieses Nachglühen einer authentischen Passion, die jede neue Ausgabe der “Edit” zum Ereignis macht für jene, die sich für ihren Gegenstand zu begeistern wissen. Wer je dem müden, scheinbar viele hundert Millionen Jahre alten Blick der Chefredakteure anderer Medien standhalten mußte, ein Blick, unter dem jede neue Idee sogleich zur Illustration der ewigen Wiederkehr des Gleichen zusammenschnurrt, ein Blick, der Äonen von Moden und Wellen gesehen haben muß und in allem Innovativen lediglich die neueste Manifestation des Altbekannten und Wohlabgehangenen zu erkennen glaubt, der wird die pfiffige Aufgewecktheit, das muntere Blitzen in den Augen des Edit-Teams zu schätzen wissen. In dieser hellwachen Aufmerksamkeit liegt auch das Geheimnis begründet, warum so viele der genannten Herausgeber, sei es als Autoren, sei es als Lektoren oder Kritiker, sich anschicken zu nicht unbedeutenden Karrieren in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Mit anderen Worten: hoch lebe das Rotationsprinzip!
Das gezeichnete Portrait der “Edit” als ein Schaukasten deutschsprachiger Gegenwartsliteratur, als ein Ort für Entdeckungen in Prosa und Lyrik wäre nicht komplett, verschwiege man, daß “Edit” auch zu den spannendsten Foren der Literaturkritik und Essayistik zählt. Ich sage dies mit einer gewissen Beklommenheit, denn hier gilt es eine vorsichtige, aber deutliche Distanzierung zum Namensgeber des heute verliehen Preises vorzunehmen.
“Jedes verneinende, tadelnde Urteil, wenn es als Beobachtung noch so richtig ist, wird falsch, sobald man es äußerst”, so Hermann Hesse. “Das Feststellen von “Fehlern”, und klinge es noch so fein und geistig, ist nicht Urteil, sondern Klatsch.” Hier irrt Hesse. Das Feststellen von Fehlern, ästhethischen Mängeln, Unsauberkeiten in der Konstruktion ist nun einmal die unabdingbare Geschäftsgrundlage aller Literaturkritik, Voraussetzung einer Analyse der Schwächen und Stärken eines Textes, und beschränkt man sich, wie Hesse selbst, ausschließlich auf Lob, Ermutigung und stets bejahende Urteile, so kündigt man einen stillschweigenden Pakt zwischen dem Leser einer Kritik und ihrem Verfasser – und erweist der Literatur selbst letztlich einen Bärendienst. Allerdings gehört dazu Mut. Die “Edit” besitzt diesen Mut und beweist ihn Ausgabe um Ausgabe in ungewöhnlichem Maß, indem sich in ihr neben wichtigen und richtungsweisenden Essays auch Kritiken zur aktuellen Produktion finden – und in diesen langen und souverän argumentieren Kritiken geht es keineswegs zimperlich zu. Es spricht sowohl für die Beredheit wie auch für die Unbestechlichkeit der
Herausgeber, daß es dennoch immer wieder gelingt, auch durchaus namhafte Autoren zur Mitarbeit zu bewegen – ein kaum zu unterschätzendes Kunststück, gleicht es es doch dem Versuch, jemandem zum Essen in ein Haus einzuladen, dessen im hinteren Teil gelegene Küche vor kannibalischen Obergriffen auf die Gäste nicht zurückschreckt. “Edit” scheint es in dieser Beziehung eher mit Ernst Jünger zu halten, der in “Autor und Autorschaft” schrieb: “Warum klagen so viele, daß sie unterschätzt werden? Schlimmer ist doch das Gegenteil.”
Wenn also ein Heros der Literaturkritik wie Joachim Kaiser unlängst in Interview “eine Abkehr von der Hochkultur” in deutschen Redaktionen feststellte und dies damit begründete, diese jungen Leute seien “gespenstisch wertblind, amusisch und banausenhafenhaft”, dann sollte ihm einmal jemand eine Ausgabe der “Edit” in die Hand drücken.
Überhaupt ist “Edit” ein Schlag ins Gesicht all derjenigen, die mit dem kulturkritischen Passepartout ‘Früher war besser’ ihrer Verrentung entgegendämmern und ihre Nichtbeachtung der zeitgenössischen deutschsprachigen Literatur rechtfertigen wollen. Wann bitteschön war das Niveau denn höher als heute? Etwa in jenen Sloterdijkschen “beispiellos finsteren Jahre” der Adenauerära, während der 68er-Zeit mit ihrer ausgeprägten Kultur des Zuhörens, ihrer Toleranz und ihrer Affinität zur Differenz im geistigen Feld, wie sie Theodor W. Adorno selig noch erleben durfte, oder vielleicht doch in jenem goldenen Dezennium deutschen Geisteslebens, den 70er Jahren, wo Schwule und Lesben noch waren, “wo sie hingehörten”, wahrhaft weitläufige Intellektuelle wie Luise Rinser und Gerhard Zwerenz das Bild bestimmten und wo Arno Schmidt in der Frankfurter Paulskirche mit weisen Worten den Arbeitern die Freude der Arbeit näherzubringen versuchte (leider konnte er das nicht selbst tun, er mußte schließlich arbeiten und schickte deshalb seine Frau in die Paulskirche, die hatte nichts Besseres zu tun, zu Hause erwartete sie nämlich nur das von Arno Schmidt eigenhändig gebastelte Bügelbrett mit Holzaufsatz zum Vokabellernen).
Nein, freuen wir uns an unserer Gegenwart, freuen wir uns so, wie sich Hermann Hesse an seiner Gegenwart freute, sein Artikel von 1920 in “Vivos voco” endet mit dem Satz: “Gerade diese Dichter aber sind es, die unsere Zeit braucht, auch wenn sie vielleicht diese Zeit nicht überdauern.” Inwiefern sich dies auf die Gegenwart übertragen läßt, können wir im Anschluß nun hören in einer kleinen Collage aus programmatischen Editorials der “Edit”, gelesen von Hubertus Gerzen, die einen Eindruck von der ästhetischen Bandbreite der Stile und Schreibweisen in Edit abbilden. Freuen wir uns darauf, freuen wir uns aber auch ,wenigstens dreimal im Jahr auf die neue “Edit”, und freuen wir uns nun mit den Edit-Herausgebern über den Hermann Hesse Preis 2002. Ad multos annos!