- Das Haus
- Newsletter
- Service
- Publikationen
- Veranstaltungen
- NEU Livestream
- Ausstellungen
- Buchmagazin & AutorInnen
- AutorInnen
- AUFTRITTE
- Rezensionen Buch
- Rezensionen 2019
- Rezensionen 2018
- Rezensionen 2017
- Rezensionen 2016
- Rezensionen 2015
- Rezensionen 2014
- Rezensionen 2013
- Pressespiegel 2000-2010
- AutorInnen A
- AutorInnen B
- AutorInnen C
- AutorInnen D
- Autorinnen E
- AutorInnen F
- AutorInnen G
- AutorInnen H
- AutorInnen I
- AutorInnen J
- AutorInnen K
- AutorInnen L
- AutorInnen M
- AutorInnen N
- AutorInnen O
- AutorInnen P
- AutorInnen Q
- AutorInnen R
- AutorInnen S
- AutorInnen T
- AutorInnen U
- AutorInnen V
- AutorInnen W
- AutorInnen Z
- Incentives
- Rezensionen Sachbuch
- Verlage
- Dank an Verlage
- Impressum
- Bibliothek & Sammlungen
- Katalogsuche
- Partnerinstitutionen

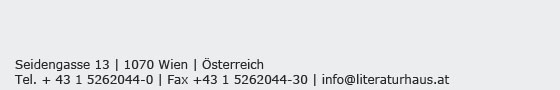
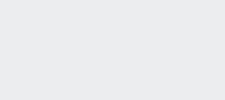


FÖRDERGEBER
PARTNER/INNEN

Martin Pollack: Kontaminierte LandschaftenLESEPROBE »Landschaft«. Dieser Begriff weckt in uns zumeist positive Empfindungen und angenehme Gefühle, vor allem wenn wir dabei, völlig unkritisch, an das freie, nicht verbaute und zersiedelte Land denken, das wir auf unseren Wanderungen und Fahrten erkunden. Wir stellen uns dabei Wiesen und Wälder, mäandernde Flüsse und Bäche, wilde Schluchten und grüne Bergrücken vor, noch nicht rücksichtslos beschädigt oder gar unwiederbringlich zerstört durch menschliche Einflüsse. Wir sehen Bilder einer schönen, alle Sinne erfreuenden Natur vor uns, wie wir sie von zahllosen Darstellungen in der Literatur und Malerei kennen. Natürlich ist dieses Verständnis des Begriffes naiv und ignoriert die neueren Landschaftstheorien und Landschaftsdebatten, die gerade in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen haben. Wenn ich ganz unreflektiert, unbelastet von theoretischen Erwägungen, den Begriff »Landschaft« höre, sehe ich zunächst einmal meine Streuobstwiesen im Südburgenland vor mir, die alten Zwetschken- und Apfelbäume, dahinter die Felder, je nach Jahreszeit und Frucht verschieden gefärbt, Schlehenhecken und einzelne Bäume, eine Esche, Birken, dann wieder Felder und schließlich den Wald, Mischwald, der den Horizont bildet. Wenn ich in meiner Bibliothek sitze und übers Land schaue, fällt mein Blick auf kein anderes Haus. So soll Landschaft sein, denke ich dann zufrieden. »Landschaft ist Natur, die im Anblick für einen fühlenden und empfindenden Betrachter ästhetisch gegenwärtig ist«, formuliert der deutsche Philosoph Joachim Ritter in seinem programmatischen Aufsatz »Landschaft« aus dem Jahre 1963. Wir sind überzeugt, dass eine Landschaft, in der auf den ersten Blick nichts unser Auge beleidigt, eine beruhigende und erholsame Wirkung ausüben und uns seelischen Frieden und Ausgeglichenheit verschaffen kann. Die Landschaft gilt im Gegensatz zum urbanen Raum als wundersamer Tröster und Heiler. Als ein Ort des Rückzugs, aus dem wir neue Kräfte schöpfen. Doch so einfach ist es nicht. Wir übersehen dabei, dass die natürlichen, scheinbar naturbelassenen Landschaften, die hier durch unseren Kopf geistern, nichts anderes sind als Chimären, Produkte unserer Einbildungskraft, die mit der Wirklichkeit wenig gemein haben. Die Landschaften, von denen ich hier spreche, sind immer von Menschen geprägt und gestaltet, manchmal sind diese Eingriffe ganz deutlich sichtbar, dann wieder weniger, sodass wir meinen könnten, wir hätten es mit unberührter, »unschuldiger« Natur zu tun. Aber Landschaft, wie wir sie kennen, ist immer von Menschen erschaffen. Dessen sind wir uns zwar bewusst, wenn wir den diffusen, mit Emotionen aufgeladenen Begriff nüchtern betrachten, doch im nächsten Moment lassen wir schon wieder unseren Gefühlen die Zügel schießen. Denn unser Verständnis von Landschaft hat viel mit Empfindungen zu tun. Und mit Imagination. Und nicht zuletzt auch mit Erinnerung. Das gilt vor allem für die Landschaften unserer frühesten Jahre, die uns, wenn wir eine gute, behütete Kindheit hatten, wie verschwommene Traumbilder durchs ganze Leben begleiten und in der Rückschau eine Ahnung von jener Vertrautheit und Geborgenheit vermitteln, die wir damals, vor langer Zeit, vermeintlich empfanden. Oder handelt es sich dabei um eine spätere Projektion? Um ein Produkt unseres Wunschdenkens? War die Umgebung, in der wir aufwuchsen, vielleicht gar nicht so heil und friedlich, wie uns das jetzt, viele Jahre später, erscheinen mag? Ich verbrachte die ersten Lebensjahre mit meiner Mutter und den Geschwistern auf einem Einschichthof im steirischen Ennstal. Aus dieser Zeit sind mir nur einzelne Bruchstücke mit großen Leerstellen dazwischen im Gedächtnis haften geblieben, doch diese Fragmente haben sich mir tief eingeprägt. Das war kurz nach dem Krieg, der seinen langen, kalten Schatten über unsere Kindheit warf. Wir waren nach der Zerstörung unseres Hauses in Linz durch amerikanische Bomben im Dezember 1944 auf Umwegen nach Mitterberg gekommen, ein kleines, weit verstreutes Dorf am Fuße des Grimming. Zuerst hatten wir bei meinen Großeltern in Amstetten Zuflucht gefunden, als jedoch die Rote Armee näher rückte, wurden wir nach Mitterberg evakuiert. Evakuiert. Allein dieses Wort beinhaltet eine Fülle von Entbehrungen und Beschwerlichkeiten, Ängsten und Unsicherheiten, die damals unseren Alltag bestimmten. Wenn ich jedoch heute an diese Zeit zurückdenke, sehe ich nur schöne und angenehme Bilder vor mir. Eine Idylle. Ich habe das Leben auf dem Land, auf dem abgelegenen Bauernhof, in jeder Hinsicht genossen, obwohl die Zeiten zweifellos schlecht waren, Notzeiten, wie man allgemein sagte, ärmlich und elend. Wir, die aus der Stadt in die dörfliche Abgeschiedenheit verschlagen worden waren, bekamen die Not besonders schmerzlich zu spüren. Als Evakuierte, von irgendwelchen Behörden fremden Bauern zugewiesen, ohne eigenes Dach über dem Kopf, waren wir noch ärmer dran als die hier Beheimateten. Der Großteil unserer Habe, Bettzeug, Kleider und Einrichtungsgegenstände, war im zerbombten Haus verbrannt. Objektiv betrachtet, war die Landschaft meiner ersten Nachkriegsjahre grau, triste und unwirtlich. (S. 5-8) © 2014 Residenz Verlag, St. Pölten - Salzburg - Wien
|
| Veranstaltungen |
|
Junge LiteraturhausWerkstatt - online
Mi, 13.01.2021, 18.00–20.00 Uhr online-Schreibwerkstatt für 14- bis 20-Jährige Du schreibst und...
Grenzenlos? (Literaturedition Niederösterreich, 2020) - online
Do, 14.01.2021, 19.00 Uhr Buchpräsentation mit Lesungen Die Veranstaltung kann über den Live... |
| Ausstellung |
|
Claudia Bitter – Die Sprache der Dinge
14.09.2020 bis 25.02.2021 Seit rund 15 Jahren ist die Autorin Claudia Bitter auch bildnerisch... |
| Tipp |
|
LITERATUR FINDET STATT
Eigentlich hätte der jährlich erscheinende Katalog "DIE LITERATUR der österreichischen Kunst-,... |
|
OUT NOW flugschrift Nr. 33 von GERHARD RĂśHM
Die neue Ausgabe der flugschrift des in Wien geborenen Schriftstellers, Komponisten und bildenden... |