- Das Haus
- Newsletter
- Service
- Publikationen
- Veranstaltungen
- Ausstellungen
- Buchmagazin & AutorInnen
- Ă–sterreichische AutorInnen
- AUFTRITTE
- Rezensionen Buch
- Pressespiegel 2000-2010
- AutorInnen A
- AutorInnen B
- AutorInnen C
- AutorInnen D
- Autorinnen E
- AutorInnen F
- AutorInnen G
- AutorInnen H
- AutorInnen I
- AutorInnen J
- AutorInnen K
- AutorInnen L
- AutorInnen M
- AutorInnen N
- AutorInnen O
- AutorInnen P
- AutorInnen Q
- AutorInnen R
- AutorInnen S
- AutorInnen T
- AutorInnen U
- AutorInnen V
- AutorInnen W
- AutorInnen Z
- Incentives
- Rezensionen Sachbuch
- Rezensionen Hörbuch
- Interviews / Portraits
- Verlage
- Dank an Verlage
- Impressum
- Bibliothek & Sammlungen
- Katalogsuche
- Museen, Festivals & Reisen
- Preise, Projekte, Archive, Tagungen, Akademien
- Literaturhäuser
- Partner

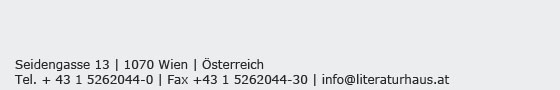
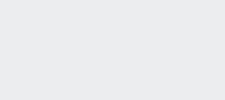
FÖRDERGEBER

PARTNER/INNEN

Margret Kreidl: Mitten ins Herz.Wien: Edition Korrespondenzen, 2005. Link zur Leseprobe Wer oft auf Reisen ist, lernt die Vorteile von Instantgerichten schätzen: Sie sind platzsparend und leicht, die wichtigsten Zutaten kehren kaum abgewandelt immer wieder und sorgen so für wohltuende Wiedererkennungs- und Gewöhnungseffekte. Eine Tasse heißes Wasser verwandelt das staubige Zeug in eine sättigende Mahlzeit für unterwegs. Es ist dieser immer wiederkehrende Schuss im ersten Teil des schmalen Bändchens, der das melodramatische Gebalze in rustikalem Ambiente nicht nur erträglich, sondern sogar vergnüglich macht. Das drastische Finale der kurzen, äußerst kitschigen Texte empfindet man beim Lesen als eine Art Gnadenschuss - auf den man sich nach einer kurzen Eingewöhnung schon freut. Es macht Spaß, dabei zu sein, wie Seite für Seite eine Heimatschnulze nach der anderen liquidiert wird: die Wilderergeschichte mit dem "jungen Grenzer" - "Ein Schuss." Das alpine Eifersuchts- und Almabtriebsdrama - "Ein Schuss." Der heldenhafte Einsatz des freiwilligen Feuerwehrmannes - "Jubel. Tusch. Ein Schuss." Manche der Kürzestgeschichten sind soweit reduziert, dass sie sogar ohne menschliche Protagonisten auskommen. Da fällt der Schuss dann inmitten einer Auflistung geologisch-gebirgiger Termini (was sind zum Beispiel "Kare und Schratten im Kalk"?), beim Aufzählen der Bestandteile einer zünftigen Brettljause oder am Ende einer Liste von besonders blumigen Blumennamen. Letztere endet bezeichnenderweise mit "Mannsblut". Ohne männliches Personal und folglich ohne Schießgewehr kommt die Autorin bei den anschließenden Kurzbiografien erfolgreicher Serienromanautorinnen aus. Das Verfahren ähnelt dem der "Schnellen Schüsse": vorhandene Texte werden von allem Überflüssigen befreit und auf einige zentrale Sätze (gelegentlich nur einen) eingedampft. Die Ausgangstexte stammen größtenteils von den Autorinnen selbst bzw. von ihren Homepages. Das Resultat sind peinliche Selbstbeweihräucherungen ("Hauptberuflich dreht sie TV-Werbefilme für eine Werbeagentur in Phoenix, Arizona. Außerdem arbeitet sie als Eheberaterin, gibt Religionsunterricht und hält Vorträge über Psychologie"), Banalitäten à la "Durch jeden Liebesroman, den sie schreibt, kommt sie sich selbst näher" oder Texte, die man auch als dringende Kaufwarnung verstehen kann: "Einmal hat sie ein Buch in vier Tagen geschrieben, durchschnittlich braucht sie zwei Wochen für einen Roman." Keine Frage: Diese Miniaturen sind um nichts weniger boshaft oder treffsicher als die im ersten Teil des Buches, auch wenn weit und breit keine Schusswaffe in Sicht ist. Dafür ist die Schlusspointe ein Knaller - doch diese sei hier nicht verraten. Georg Renöckl Originalbeitrag Für die Rezensionen sind die jeweiligen Verfasser verantwortlich. Sie geben nicht notwendig die Meinung der Redaktion wieder.
|
| Veranstaltungen |
|
Junge LiteraturhausWerkstatt
Mo, 05.02. bis Mi, 07.02.2018, 15.00–19.00 Uhr Dreitägiger Schreibworkshop für...
Verleihung der Ăśbersetzerpreise der Stadt Wien 2016 & 2017
Do, 08.02.2018, 19.00 Uhr Preisverleihung & Lesung Der mit € 3.700 dotierte Übersetzerpreis... |
| Ausstellung |
| Tipp |
|
flugschrift Nr. 22 – Paul Divjak
Mit Rebranding flugschrift greift der Autor und KĂĽnstler Paul Divjak das Thema von... |
|
Incentives – Austrian Literature in Translation
Neue Beiträge zu Clemens Berger, Sabine Gruber, Peter Henisch, Reinhard Kaiser-Mühlecker, Barbi... |