- Das Haus
- Newsletter
- Service
- Publikationen
- Veranstaltungen
- Ausstellungen
- Buchmagazin & AutorInnen
- Ă–sterreichische AutorInnen
- AUFTRITTE
- Rezensionen Buch
- Pressespiegel 2000-2010
- AutorInnen A
- AutorInnen B
- AutorInnen C
- AutorInnen D
- Autorinnen E
- AutorInnen F
- AutorInnen G
- AutorInnen H
- AutorInnen I
- AutorInnen J
- AutorInnen K
- AutorInnen L
- AutorInnen M
- AutorInnen N
- AutorInnen O
- AutorInnen P
- AutorInnen Q
- AutorInnen R
- AutorInnen S
- AutorInnen T
- AutorInnen U
- AutorInnen V
- AutorInnen W
- AutorInnen Z
- Incentives
- Rezensionen Sachbuch
- Rezensionen Hörbuch
- Interviews / Portraits
- Verlage
- Dank an Verlage
- Impressum
- Bibliothek & Sammlungen
- Katalogsuche
- Museen, Festivals & Reisen
- Preise, Projekte, Archive, Tagungen, Akademien
- Literaturhäuser
- Partner

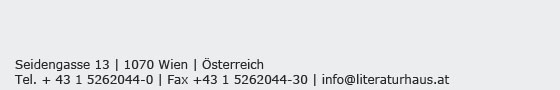
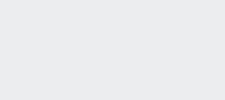
FÖRDERGEBER

PARTNER/INNEN

Leseprobe: Christoph Braendle - Onans Kirchen.Manchmal rede ich mit dem Hirten, der keine Sprache hat und mit dem auch sonst wenig anzufangen ist (er geht ja in der Früh mit den Schafen los und kehrt erst am Abend heim). Manchmal lade ich ihn zu mir und zum Essen ein. Es scheint ihm zu schmecken, aber er bleibt nie lange. Meistens schläft er früh. Manchmal sitzen ein paar Freunde um sein Feuer, kleine, magere, tiefschwarze, von denen ich nicht weiß, wann und woher sie gekommen sind. Trotzdem sind das keine sauvages, sie tragen Hemd und Hose, die meisten haben Schuhe, einer trägt ein Leibchen von der UCLA, der University of California at Los Angeles....weiß der Teufel, von wem er es bekommen hat.
Heute hat sich der Hirte besonders albern benommen. Ich herrschte ihn an. Er verschwand, um wenig später wieder aufzutauchen, mit einem Fetzen Papier. Es war eine vor dreiundsechzig Jahren von einem evangelischen Missionar ausgestellte Urkunde: Ein Sechsjähriger war auf den Namen Christo Gerdula getauft worden. Endlich begriff ich.
© 2012 Czernin-Verlag, Wien.
|
| Veranstaltungen |
|
Junge LiteraturhausWerkstatt
Mo, 05.02. bis Mi, 07.02.2018, 15.00–19.00 Uhr Dreitägiger Schreibworkshop für...
Verleihung der Ăśbersetzerpreise der Stadt Wien 2016 & 2017
Do, 08.02.2018, 19.00 Uhr Preisverleihung & Lesung Der mit € 3.700 dotierte Übersetzerpreis... |
| Ausstellung |
| Tipp |
|
flugschrift Nr. 22 – Paul Divjak
Mit Rebranding flugschrift greift der Autor und KĂĽnstler Paul Divjak das Thema von... |
|
Incentives – Austrian Literature in Translation
Neue Beiträge zu Clemens Berger, Sabine Gruber, Peter Henisch, Reinhard Kaiser-Mühlecker, Barbi... |