- Das Haus
- Newsletter
- Service
- Publikationen
- Veranstaltungen
- Ausstellungen
- Buchmagazin & AutorInnen
- Ă–sterreichische AutorInnen
- AUFTRITTE
- Rezensionen Buch
- Pressespiegel 2000-2010
- AutorInnen A
- AutorInnen B
- AutorInnen C
- AutorInnen D
- Autorinnen E
- AutorInnen F
- AutorInnen G
- AutorInnen H
- AutorInnen I
- AutorInnen J
- AutorInnen K
- AutorInnen L
- AutorInnen M
- AutorInnen N
- AutorInnen O
- AutorInnen P
- AutorInnen Q
- AutorInnen R
- AutorInnen S
- AutorInnen T
- AutorInnen U
- AutorInnen V
- AutorInnen W
- AutorInnen Z
- Incentives
- Rezensionen Sachbuch
- Rezensionen Hörbuch
- Interviews / Portraits
- Verlage
- Dank an Verlage
- Impressum
- Bibliothek & Sammlungen
- Katalogsuche
- Museen, Festivals & Reisen
- Preise, Projekte, Archive, Tagungen, Akademien
- Literaturhäuser
- Partner

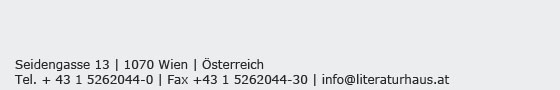
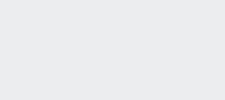
FÖRDERGEBER

PARTNER/INNEN

Leseprobe: Thomas Glavinic - Meine Schreibmaschine und ichSo wenig ich über die Herkunft meiner Ideen weiß, so genau kenne ich die Entwicklung, die ich mit ihnen nehme, wenn ich mich einmal dazu entschlossen habe, aus ihnen einen Roman zu machen. Zunächst tue ich nämlich gar nichts. Das hat zum einen damit zu tun, dass ich ein fauler Mensch bin, vor allem aber geht es mir darum, eine Idee wachsen zu lassen. Ich rede nicht darüber, ich erzähle sie niemandem, ich beratschlage mich nicht mit Freunden oder meiner Lektorin, ich lasse sie sacken und warte ab, was passiert. Manche Ideen verblassen, aus ihnen wäre kein guter Roman geworden. Manche werden größer, stärker, nehmen mich mehr und mehr gefangen. Das ist der Punkt, an dem ich etwas unternehmen muss. Bei manchen Romanen weiß ich schon im Vorhinein, dass es zwar möglicherweise auch beglückend sein würde, sie zu schreiben, dass sie mich aber auch mit Abgründen konfrontieren werden, und das bedeutet Unannehmlichkeiten. |
| Veranstaltungen |
|
Junge LiteraturhausWerkstatt
Mo, 05.02. bis Mi, 07.02.2018, 15.00–19.00 Uhr Dreitägiger Schreibworkshop für...
Verleihung der Ăśbersetzerpreise der Stadt Wien 2016 & 2017
Do, 08.02.2018, 19.00 Uhr Preisverleihung & Lesung Der mit € 3.700 dotierte Übersetzerpreis... |
| Ausstellung |
| Tipp |
|
flugschrift Nr. 21 – MARK Z. DANIELEWSKI
Dem amerikanischen Autor Mark Z. Danielewski gelang es mit seinem Roman-Debut Das... |
|
Incentives – Austrian Literature in Translation
Neue Beiträge zu Clemens Berger, Sabine Gruber, Peter Henisch, Reinhard Kaiser-Mühlecker, Barbi... |