- Das Haus
- Newsletter
- Service
- Publikationen
- Veranstaltungen
- Ausstellungen
- Buchmagazin & AutorInnen
- Ă–sterreichische AutorInnen
- AUFTRITTE
- Rezensionen Buch
- Pressespiegel 2000-2010
- AutorInnen A
- AutorInnen B
- AutorInnen C
- AutorInnen D
- Autorinnen E
- AutorInnen F
- AutorInnen G
- AutorInnen H
- AutorInnen I
- AutorInnen J
- AutorInnen K
- AutorInnen L
- AutorInnen M
- AutorInnen N
- AutorInnen O
- AutorInnen P
- AutorInnen Q
- AutorInnen R
- AutorInnen S
- AutorInnen T
- AutorInnen U
- AutorInnen V
- AutorInnen W
- AutorInnen Z
- Incentives
- Rezensionen Sachbuch
- Rezensionen Hörbuch
- Interviews / Portraits
- Verlage
- Dank an Verlage
- Impressum
- Bibliothek & Sammlungen
- Katalogsuche
- Museen, Festivals & Reisen
- Preise, Projekte, Archive, Tagungen, Akademien
- Literaturhäuser
- Partner

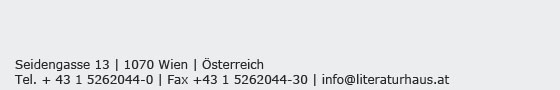
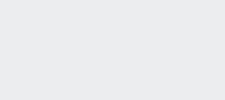
FÖRDERGEBER

PARTNER/INNEN

Leseprobe: Richard Berczeller - Fahrt ins Blaue.aus „Unser Maximilian“: Ein paar Tage später war Vater wieder daheim. Er brachte die Kopie eines von ihm unterschriebenen Dokuments mit. Darin hatte er „freiwillig“ auf seine Pensionsansprüche verzichtet. Langsam aber sicher dämmerte jetzt auch Mutter, dass sich die Zeiten tatsächlich geändert hatten. Von nun an strengte ich mich noch mehr an. Ich schrieb Briefe und schickte sie in alle Welt – an Freunde, an Unbekannte, deren Namen ich im Telefonbuch gefunden hatte, an jeden, der uns irgendwie zur Flucht verhelfen könnte. Dann erfuhr ich, dass ich wieder verhaftet werden sollte, und schlief von da an nur noch bei Freunden. Antworten auf meine Briefe, sofern überhaupt welche kamen, erhielt ich postlagernd. Am zehnten April ging ich aufs Postamt und bekam einen Brief ausgehändigt. Ich konnte mir gut vorstellen, was drinstand – bloß wieder ein paar trostlose Zeilen und leider keine Hilfe. Doch diesmal war es anders. Nachdem ich den Brief gelesen hatte, rannte ich den ganzen Weg nach Hause. „Mama!“, rief ich. „Es ist endlich da! Wir haben ein Visum!“ Sie stand mit dem Rücken zu mir, hielt in beiden Händen einen Topf Wasser und wandte den Kopf um. „Ein Visum? Ein Visum. Gut. Und wohin, Richard? In welches Land?“ „Mexiko.“ „Mexiko?“ „Ja, Mama. Mexiko.“ Sie drehte sich zu mir um. „Nein, nein“, sagte sie. „Das fällt mir ja gar nicht ein. Ich gehe doch nicht in ein Land, wo sie unseren Maximilian umgebracht haben.“ Sie weigerte sich, Österreich zu verlassen, bis ein paar Monate später das Gerücht kursierte, dass die Gestapo beabsichtige, Vater neuerlich zu verhaften. (S. 143 f)
© 2012 Czernin Verlag, Wien.
|
| Veranstaltungen |
|
Junge LiteraturhausWerkstatt
Mo, 05.02. bis Mi, 07.02.2018, 15.00–19.00 Uhr Dreitägiger Schreibworkshop für...
Verleihung der Ăśbersetzerpreise der Stadt Wien 2016 & 2017
Do, 08.02.2018, 19.00 Uhr Preisverleihung & Lesung Der mit € 3.700 dotierte Übersetzerpreis... |
| Ausstellung |
| Tipp |
|
flugschrift Nr. 22 – Paul Divjak
Mit Rebranding flugschrift greift der Autor und KĂĽnstler Paul Divjak das Thema von... |
|
Incentives – Austrian Literature in Translation
Neue Beiträge zu Clemens Berger, Sabine Gruber, Peter Henisch, Reinhard Kaiser-Mühlecker, Barbi... |