- Das Haus
- Newsletter
- Service
- Publikationen
- Veranstaltungen
- Ausstellungen
- Buchmagazin & AutorInnen
- Bibliothek & Sammlungen
- Katalogsuche
- Museen, Festivals & Reisen
- Preise, Projekte, Archive, Tagungen, Akademien
- Literaturhäuser
- Partner

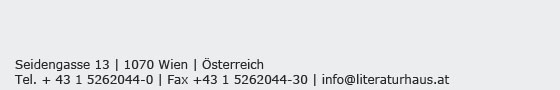
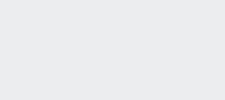
FÖRDERGEBER

PARTNER/INNEN

Paul Celan, Gisèle Celan-Lestrange: BriefwechselGelesen von Bodo Primus und Eva Garg Selten ist die Ausgabe eines Briefwechsels und auch die dazugehörige Hörbuchversion (interessanterweise eine Produktion des Saarländischen Rundfunks 2001) so hymnisch aufgenommen worden wie jene von Paul Celan und Gisèle Celan-Lestrange. Das beweisen allein schon die Titel von Besprechungen der 2001 erschienen Buchausgabe: "Uns zu trennen wäre der Sieg unserer Feinde" (Ernst Osterkamp in der FAZ, 21. 4. 2001), "Liebe, zwangsjackenschön" (Beatrice von Matt, NZZ, 1.7.2001), "Der Verband der Weltvertriebenen" (Richard Reichensperger, Der Standard, 30.6.2001), oder die des Hörbuchs: "Sprachbunker der Liebe" (Felicitas von Lovenberg, FAZ, 13.7.2002). Tatsächlich ist der 30 Jahre nach dem Freitod Paul Celans herausgegebene Briefwechsel inhaltlich ein berührendes Dokument einer Liebe und editorisch ein Musterbeispiel seiner Gattung - dem auch die Gestaltung des Hörbuchs nicht nachsteht. Aus rund 700 Briefen zwischen Dezember 1951 und März 1970 wurden etwa 100 für das Hörbuch, respektive den Hörfunk ausgewählt (und vom Suhrkamp Verlag sowie dem Herausgeber der französischen Originalversion Bertrand Badiou autorisiert), und es kann als große Leistung angesehen werden, dass die Leitthemen des ungewöhnlich umfangreichen Briefwechsels in dieser kleinen Auswahl präsent bleiben. Die Hörbuchversion folgt der Buchausgabe insofern, als sie die drei Zeitabschnitte der Korrespondenz beibehält: Die Zeit des Kennenlernens, des gegenseitigen Sich-Vergewisserns, die zweite Phase des gemeinsamen Lebens und Arbeitens bis 1967, unterbrochen von zahlreichen Auslandsaufenthalten Celans, vorwiegend in Deutschland auf Leserreisen, Verlagskontakte zu pflegen u.ä., geprägt auch durch den frühen Tod des ersten Sohnes und Celans Wiederaufnahme der Liebesbeziehung zu Ingeborg Bachmann. Schließlich die dritte Phase nach der Trennung, in der sich die beiden nur noch bei besonderen Gelegenheiten sehen, Bilder aus der Vergangenheit, Berichte über den Sohn und die künstlerische Arbeit eine gelebte Beziehung ersetzen müssen. Der Briefwechsel jener außergewöhnlich ebenbürtigen Partner beginnt mit Gisèle Lestranges erstem erhaltenen Brief an Celan. Die Bedeutungsfelder "Ruhe" und "Frieden" durch und in der Beziehung nehmen einen zentralen Stellenwert ein und scheinen bereits auf die späteren Jahre von Celans nicht aufzuhaltender psychischer Zerrissenheit vorauszuweisen. Angst und Furcht, Hoffnung, Wahrhaftigkeit und Klarheit, Standhalten und die versuchte Gegenwelt ihrer Beziehung bilden den Kern des Briefwechsels - auch dort, wo es um künstlerische Arbeit, Lektüre, Bekannte und Freunde oder das tägliche Leben geht. In den Briefen der letzten Jahre teilt sich Celan fast nur mehr über seine Gedichte mit - mit oder ohne begleitende Übersetzung - Gedichte als Gespräch, eine letzte Bastion eines Lebens in psychiatrischen Kliniken. Originalbeitrag Ulrike Diethardt |
| Veranstaltungen |
|
Junge LiteraturhausWerkstatt
Mo, 05.02. bis Mi, 07.02.2018, 15.00–19.00 Uhr Dreitägiger Schreibworkshop für...
Verleihung der Ăśbersetzerpreise der Stadt Wien 2016 & 2017
Do, 08.02.2018, 19.00 Uhr Preisverleihung & Lesung Der mit € 3.700 dotierte Übersetzerpreis... |
| Ausstellung |
| Tipp |
|
flugschrift Nr. 21 – MARK Z. DANIELEWSKI
Dem amerikanischen Autor Mark Z. Danielewski gelang es mit seinem Roman-Debut Das... |
|
Incentives – Austrian Literature in Translation
Neue Beiträge zu Clemens Berger, Sabine Gruber, Peter Henisch, Reinhard Kaiser-Mühlecker, Barbi... |