- Das Haus
- Newsletter
- Service
- Publikationen
- Veranstaltungen
- Ausstellungen
- Buchmagazin & AutorInnen
- Bibliothek & Sammlungen
- Katalogsuche
- Museen, Festivals & Reisen
- Preise, Projekte, Archive, Tagungen, Akademien
- Literaturhäuser
- Partner

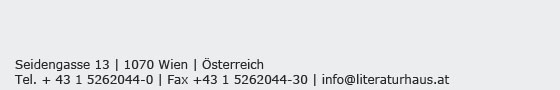
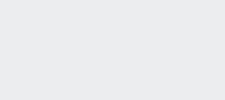
FÖRDERGEBER

PARTNER/INNEN

Elias Canetti: Das Hörwerk. 1953 - 1991Prosa, Dramen, Essays, Vorträge, Reden, Gespräche 33 Stunden und sechs Minuten Tondokumente. Canetti liest aus seinem Werk vor und führt Gespräche, gibt Interviews. Das wären 33 CDs, hier auf zwei MP3-CDs komprimiert. Eine erste umfassende Sammlung. Der Verlag begeht nicht den Fehler, sie als Gesamtausgabe zu bezeichnen, wie das einige Rezensenten getan haben. Es ist eine erste Zusammenstellung des Materials, das sich in den Rundfunkarchiven der deutschsprachigen Sender ohne große Mühe finden ließ. Nachforschungen in österreichischen Archiven, zum Beispiel der Phonothek, würden gewiss eine Reihe weiterer Lesungen und Gespräche Canettis zu Tage fördern, die in Wien in den 60er und 70er Jahren entstanden sind. Doch die vorliegende Auswahl aus nahezu 40 Jahren ist imposant genug. Elias Canetti hat von Karl Kraus das Vorlesen gelernt. Dessen öffentliche Vorlesungen hat er begeistert besucht. Und auch, wenn er sich später von ihm abwandte, so hat er sich doch dessen Kunst des Vortrags zu eigen gemacht. Karl Kraus las ja nicht nur eigene Texte, sondern schuf eine Art Hörbühne, wenn er Shakespeares, Nestroys oder Hauptmanns Dramen zur Gänze vortrug, allein sämtliche Rollen sprechend. Immer schon waren die Autoren Rhapsoden ihrer eigenen Werke gewesen, doch erst Karl Kraus stellte sich zunehmend in den Dienst der von ihm bevorzugten Dramatiker, später kamen noch Offenbachs Operetten hinzu. Nicht eben sehr modulationsfähig, gerieten seine Interpretationen zu Höhepunkten der Vortragskunst, die das Ausstattungstheater seiner Zeit (Max Reinhardt) verdrängen sollten. Seine Vorbilder waren die Schauspieler des alten Burgtheaters vor dem Umzug ins neue Haus am Ring 1888. Die hatten noch wortdeutlich deklamiert, verkündete er. So waren die szenischen Lesungen von Karl Kraus nicht bloße Rezitationen, sondern wollten die Szenen in der Phantasie des Zuhörers evozieren. Das Krähen und Krächzen der verteilten Rollen und Couplets hatte seinen eigenen Sog, den man noch heute an alten Aufnahmen nachvollziehen kann, doch schließt die Monotonie des Vortrags allmähliche Ermattung der Hörer nicht aus. Canetti hat daraus gelernt und den Stil des Meisters weiterentwickelt. Seine Lesungen sind rhythmisch gegliedert und rollengerecht moduliert, sodass Langeweile nicht aufkommt. Solange es keine Notationsmethode für den öffentlichen Vortrag gibt, bleiben seine Lesungen die einzig verbindlichen Anweisungen, wie seine Dramen modellhaft nachzuspielen und seine Prosa vorzulesen wären. Das ist ein Vorteil und ein Nachteil zugleich. Der Vorteil ist die Authentizität. Wir wissen, wie es der Autor verstanden wissen wollte. Der Nachteil ist die Einengung. Man kann sich Lektüre oder Darstellung auf der Bühne schwer anders vorstellen als in der von Canetti vorgeprägten Weise. Bei den ersten Inszenierungen seiner Dramen war es üblich, ihn zu bitten, den Schauspielern das Hörmodell seiner Auffassung zu liefern, dem dann auf der Bühne nachgestrebt wurde. Damit sind Abweichungen, Eigenwilligkeiten, Varianten zu Lebzeiten unterbunden worden. Das schränkte zwar die Vielfalt der Interpretationsmöglichkeiten ein, gab aber auch die Sicherheit, den Sinn des Autors so gut wie möglich zu treffen, "werkgetreu" sozusagen. Den größten Teil seines Werkes hat Canetti im Lauf der Jahre vorgelesen. Er begann noch vor der ersten Veröffentlichung in den dreißiger Jahren in Wien mit der "Komödie der Eitelkeit" und ausgewählten Kapiteln aus der "Blendung". Nach dem Krieg wurde er zum erstenmal 1954 vom Süddeutschen Rundfunk zu einer halbstündigen Lesung aus der "Komödie" gebeten. Da war noch nichts von ihm wieder in den Buchhandlungen erhältlich. Fünf Jahre später, kurz vor der Veröffentlichung von "Masse und Macht", las er ausgewählte Kapitel für den Norddeutschen Rundfunk. Anfang der 60er Jahre entstanden die ersten Gespräche vor dem Mikrofon. Seine Partner waren Psychoanalytiker und Soziologen wie Alexander Mitscherlich und René König, die ihre Analyse der deutschen Nachkriegsgesellschaft in die Diskussion einbrachten. Ein missglücktes Gespräch mit Theodor W. Adorno, dem eher an Überzeugung als an Auseinandersetzung gelegen war, wurde 1962 vom Norddeutschen Rundfunk gesendet. Die "Komödie der Eitelkeit" wurde 1973 in einer einstündigen Kurzfassung vom NDR aufgenommen, "Die Hochzeit" 1974 zur Gänze (112 Minuten) vom Westdeutschen Rundfunk. Vom dritten Drama, "Die Befristeten", ist nur eine Probe von 37 Sekunden vertreten. 1981 hat der Hanser Verlag neben den beiden anderen Dramen auch zwei Tonband-Kassetten mit der Lesung der "Befristeten" herausgebracht, die hier nicht berücksichtigt werden. Zwischen 1965 und 1975 wurden Teile der Aufzeichnungen, Essays und der Charaktere des "Ohrenzeugen" im Hörfunk publiziert. Schon 1956 brachte der Süddeutsche Rundfunk zwei Kapitel aus den "Stimmen von Marrakesch" ("Der Unsichtbare" und "Begegnungen mit Kamelen"), die erst 1968 als Buchfassung herauskamen und Canettis Ruhm bei der breiten Leserschaft begründeten, der "Masse und Macht" zu schwer und der Roman "Die Blendung" zu schwierig war. Die Lesung des ersten Bandes der autobiografischen Trilogie, "Die gerettete Zunge", wurde in fünf Folgen im Januar und Februar 1977 vom Süddeutschen Rundfunk gesendet (insgesamt nahezu vier Stunden). Der Bayerische Rundfunk brachte sechs kürzere Folgen des dritten Bandes, "Das Augenspiel", im Dezember 1985 heraus; da war Canetti achtzig Jahre alt geworden und seit vier Jahren Nobelpreisträger. 1991 setzte er sich ein letztes Mal ins Studio und las das Kapitel "Der Spaziergang" aus der "Blendung". Begleitet werden die Lesungen von Interviews mit Hans Schwab-Felisch, Heinz-Klaus Metzger, Rudolf Hartung, Hans Heinz Holz, Leonhard Reinisch, Heinz Fischer-Karwin, Thilo Koch, Joachim Schickel, Falk vom Hofe, Wilfried F. Schoeller, wobei die besondere Intimität des Gesprächs mit Friedrich Witz, seinem Zürcher Geschichtslehrer, dem Gründer des Artemis-Verlages, den er sich als Partner ausdrücklich gewünscht hatte, besonders hervorzuheben ist (23. 8. 1967, Süddeutscher Rundfunk). Elias Canetti war ein vorzüglicher Interpret seiner Werke. Mehr noch: Das gesprochene, das gehörte und das geschriebene Wort gehören zusammen. In einer seiner Aufzeichnungen bringt er es auf den Punkt: "Wenn du dein Leben niederschreibst, müsste auf jeder Seite etwas sein, von dem noch nie ein Mensch gehört hat." Seine Texte wollen eher gehört als gelesen sein. Er hat sie nicht fürs Lesen geschrieben, sondern zum Hören. Er konnte zuhören. Sein Hören war so produktiv animierend, so einladend und auf einnehmende Weise sympathisch, dass es kaum jemand gab, der nicht ihm, dem unermüdlichen und das Gehörte für Jahrzehnte speichernden Zuhörer, lustvoll erzählend alles preisgab, sich ihm auslieferte. Canetti gab dem Gesprächspartner das Gefühl, dass dieser ihm etwas Wichtiges, Einmaliges und Wertvolles zu sagen habe. Und dass er dies auf unverwechselbare Weise sagte. Aus dieser Methode des spezifizierenden Hörens hatte er schon in den 30er Jahren eine eigene Theorie entwickelt, die bis heute zumeist unreflektiert das Rezeptionsklischee bestimmt: die Theorie von der "akustischen Maske". Jedem Menschen gesteht Canetti eine "eigentümliche Art des Sprechens" zu. Seine "Sprechweise ist einmalig und unverwechselbar. Sie hat ihre eigene Tonhöhe und Geschwindigkeit, sie hat ihren eigenen Rhythmus. Er hebt die Sätze wenig voneinander ab. Bestimmte Worte und Wendungen kehren immer wieder. Überhaupt besteht seine Sprache aus nur fünfhundert Worten. Er behilft sich recht gewandt damit. Es sind seine fünfhundert Worte. Ein anderer, auch wortarm, spricht andere fünfhundert. Sie können ihn, wenn Sie ihm gut zugehört haben, das nächste Mal an seiner Sprache erkennen, ohne ihn zu sehen. Er ist im Sprechen so sehr Gestalt geworden, nach allen Seiten hin deutlich abgesetzt, von allen übrigen Menschen verschieden, wie etwa in seiner Physiognomie, die ja auch einmalig ist. Diese sprachliche Gestalt eines Menschen, das Gleichbleibende seines Sprechens, diese Sprache, die mit ihm entstanden ist, die er für sich allein hat, die nur mit ihm vergehen wird, nenne ich seine akustische Maske." Canetti wirft hier zwei Dinge in einen Topf: Wortschatz und Sprechweise. Die Wortwahl kann sehr wohl bei vielen Menschen gleich sein, der Thesaurus verarmt mit zunehmender Bereitschaft zur Reproduktion von Redensarten und Gemeinplätzen; ebenso wie es aktuelle "look-alike"-Mode ist, die eigene Physiognomie zugunsten der Angleichung an ein Idol, notfalls auch mittels chirurgischer Eingriffe aufzugeben. Nivellierung des Individuellen wird nicht nur in Diktaturen befördert, sie ist auch ein Kennzeichen scheindemokratischer Gleichmacherei. Was als "akustische Maske" bleibt, ist die Unverwechselbarkeit der Stimme. Die besteht bei jedem Menschen aus einem einmaligen Konglomerat von Färbung, Betonung, Tonhöhe, Rhythmus, Duktus, an dem man einen jeden akustisch identifizieren kann. Man erkennt den Menschen an der Stimme, sagt der Volksmund. Diese Eigentümlichkeit ist also eigentlich keine "Maske", die man verändern, wechseln, abnehmen, austauschen könnte. Die unverwechselbare Prägung schlägt durch Dialekte, Stimmungslagen, Befindlichkeiten, Ausdrucksmodulationen durch. Es gibt keine Maskenfreiheit. Camouflage ist den meisten nicht gegeben. Wenigen aber doch. Das sind die Stimmenimitatoren, die andere Unverwechselbare täuschend echt nachmachen können. Was für ein Gewinn wäre es, wenn wir auf ähnliche Weise die vorlesende Stimme uns wichtiger Autoren zur Verfügung hätten. (Ähnlich umfangreich dürfte nur das "Hörwerk" Thomas Manns sein, das jedoch in seiner gravitätischen Gleichförmigkeit an die Komödiantik Canettis nicht heranreicht.) Wenn wir wüssten, wie Robert Musil oder Heinrich Mann ihre großen Romane gesprochen hätten! Myriaden von Missverständnissen könnten ausgeräumt werden oder wären nie entstanden, wenn wir zum Beispiel hören könnten, wie Heinrich Heine seine Gedichte augenzwinkernd ironisch rezitiert hätte. Eine unübersehbare Menge von sentimentalen, romantisierenden Liedvertonungen würden wir vermissen müssen. Canetti hat den Tod nur bekämpfen, naturgemäß nicht besiegen können. Dem endgültigen Tod durch Vergessenwerden hat er mit seinen Lesungen eine eindrucksvolle Barriere entgegengesetzt. Reinhard Urbach Originalbeitrag Für die Rezensionen sind die jeweiligen Verfasser verantwortlich. Sie geben nicht notwendig die Meinung der Redaktion wieder. |
| Veranstaltungen |
|
Junge LiteraturhausWerkstatt
Mo, 05.02. bis Mi, 07.02.2018, 15.00–19.00 Uhr Dreitägiger Schreibworkshop für...
Verleihung der Ăśbersetzerpreise der Stadt Wien 2016 & 2017
Do, 08.02.2018, 19.00 Uhr Preisverleihung & Lesung Der mit € 3.700 dotierte Übersetzerpreis... |
| Ausstellung |
| Tipp |
|
flugschrift Nr. 21 – MARK Z. DANIELEWSKI
Dem amerikanischen Autor Mark Z. Danielewski gelang es mit seinem Roman-Debut Das... |
|
Incentives – Austrian Literature in Translation
Neue Beiträge zu Clemens Berger, Sabine Gruber, Peter Henisch, Reinhard Kaiser-Mühlecker, Barbi... |