- Das Haus
- Newsletter
- Service
- Publikationen
- Veranstaltungen
- Ausstellungen
- Buchmagazin & AutorInnen
- Bibliothek & Sammlungen
- Katalogsuche
- Museen, Festivals & Reisen
- Preise, Projekte, Archive, Tagungen, Akademien
- Literaturhäuser
- Partner

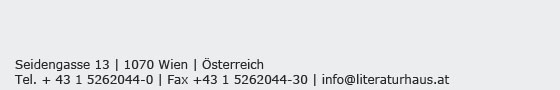
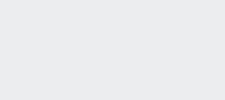
FÖRDERGEBER

PARTNER/INNEN

Elias Canetti: Der OhrenzeugeEs lesen: Elke Heidenreich, Konrad Beikirchner Wer "Der Ohrenzeuge" kennt, diesen eigentümlichen Spaziergang Elias Canettis im Grenzgebiet zwischen Erzählprosa/Aphoristik hüben und "experimenteller Literatur" drüben, weiß, welche Anforderungen er an den Rezipienten stellt. Scheinbar einfache, unmißverständliche Sätze reihen sich da aneinander, und nur hin und wieder, keineswegs aber in jedem Text der Sammlung, blitzt eine Figur auf, die klar macht, daß nichts so einfach ist, wie es scheint, die den Blick auf alles andere im Text verändert: Nicht mit gehobener Alltagssprache hat man es zu tun, so sagt einem diese Stelle dann, auch wenn man mit dieser Annahme bis zu ihr recht gut gefahren ist. Man muß von neuem zu lesen beginnen, die oberflächlich klaren Sätze neu entziffern, als wären sie Zeilen oder Absätze eines Gedichtes. Erst an diesen Bruchstellen kommt ins Spiel, was die Texte jenseits der rein inhaltlichen Ebene - auf der sie sich als "Typologie" darstellen, als Bilderbuch und Enzyklopädie der Menschen, wie sie einem auf der Straße und im Stammlokal so über den Wag laufen, nach der Natur und Geschichte ihrer (als Selbverständlichkeit vorausgesetzten) Verletztheit katalogisiert - miteinander verbindet. Denn unterhalb dieser Typologie lauern Geschichten, enträtselbar nur individuell (mithin antitypologisch) und nach Art chinesischer Lyrik aus Andeutungen, Brüchen im Sprachduktus. Die wenigen Fälle, in denen diese zweite Ebene (auf der CD etwa in "Der Leichenschleicher" und "Der Mannstolle") ganz offen zutageliegt als integraler Bestandteil auch des vordergründig Referierten, wirken auf den Gesamtaufbau ebenso als Brüche wie die "rätselhaften", "dunklen" Sätze auf den Aufbau des einzelnen Textes. Eine formal durchdachtere Abhandlung der Entfremdungen, die der Mensch in der Gesellschaft erleiden "muß" (so die Unterstellung), ist schwer vorstellbar: Der Einzelne, realisiert und vor Augen gebracht nur als Teil einer Reihe, sein Eigenstes, Innerstes, das Unterscheidungskriterium von den Anderen in der Reihe, der Rest, der ihn vor dem Absacken in völlige Bedeutungslosigkeit rettet, ist einzig - so spricht die Form und so vermeidet es Canetti gekonnt, die Texte selbst sprechen zu lassen - seine Neurose, und die wiederum entstammt der Beziehung des Ich zur Objektwelt, die den Canetti'schen Neurotikern in Fixierung auf den einen Kristallisationspunkt erstarrt ist, einerlei, ob dieser sich jetzt im Weiß der Tischtücher der "Tischtuchtollen" oder - ganz direkt - im sozialen Status zeigt, der dem "Maestroso" Anbeterscharen sichert und ihn so permanent vor dem Alleinesein schützt. Daß den erwähnten Brüchen beim Hören eine ganz andere Funktion zukommt als beim Lesen, daß man als Rezipient nämlich nur in Ausnahmefällen "zurückblättert", um den Text erneut zu erschließen, sondern daß man stattdessen versucht, sich auf all das, was der aufrüttelnden Stelle noch folgt, auf veränderte, weniger vertrauensselige Art einzulassen, war Elke Heidenreich und Konrad Beikirchner wohl ebensosehr bewußt wie die Schwierigkeiten der Auswahl und Anordnung der Texte. Nicht die Lesung eines Buches geschieht auf ihrer CD, sondern die Neuerschließung eines von Canetti sozusagen nur bereitgestellten Materials. Man merkt das der CD ebenso an wie die kindliche Freude der beiden am Ausloten der Möglichkeiten der menschlichen Stimme: In der "Maske" der jeweils gezeichneten Persönlichkeit tragen sie die Texte vor (was so wirkt, als würde man Menschen zuhören, die sich selbst in all ihrer Bedingtheit von außen beobachten, ohne dabei mit der Bedingtheit des Vokabulars auch die Bedingtheit der Sprache selbst abzulegen) und überzeichnen stets nur genau so weit, daß es die wohlverstandene Demut des "nur" interpretierenden Künstlers dem interpretierten Werk gegenüber nicht infrage stellt. Erst, wo ein Text wirklich darum bettelt, wird die Figur parodiert, und zwar ein einziges Mal ganz am Schluß, bei "Die Geworfene", in welchem Text Canetti von dem Charakter einer Frau spricht, von der so mancher wesentlich weniger nobel, aber in aller Knappheit sehr präzise als von einem "Fickfroscherl" sprechen würde. Man merkt, kurz gesagt, den beiden Vortragenden an, daß sie ihre Sprechstimmen als Instrumente zu nutzen gelernt haben. Eine Assoziation mit Schauspielkunst und Theater wird auch insofern geweckt, als die Lesenden es subtil verstehen, die erwähnten Bruchstellen einzuleiten, ihnen durch vom Autor nicht intendierte emotionale Nuancen im Vortrag einen latenten neuen Kontext zuzuweisen und so die Rezeptionsereignisse des vor und des nach dem Bruch gehörten miteinander zu verkitten, ebenso, wie dies im (zu)vielgescholtenen "modernen Regietheater" mit den sogenannten Klassikern geschieht. So begegnen sie der oben erwähnten Schwierigkeit des akustischen Mediums, in dem einmal Gesagtes für den Hörer nicht so ohne weiteres wiederholbar ist, ohne ihn nachhaltig aus dem Fluß des Textkonsums zu reißen. Daß sowohl Canetti als auch das Team Heidenreich/Beikirchner viel weniger Boshaftigkeit angesichts ihrer Kreaturen walten ließen, als man das bei zweitem Hinsehen für möglich hielte, spricht für die "Objektivität" sprachlichen Ausdrucks: Von bemitleidenswerten bis hin zu einfach nur ekelerregenden Gestalten sind in dieser Freakshow der menschlichen Seele alle Figuren klar als das erkennbar, was sie sind, auch ohne daß der auktoriale Erzähler (im Hörbuch ohnehin relativiert durch die erwähnten "Stimmmasken") nur ein einziges Mal sich herablassen müßte, Geschildertes zu bewerten. Aus Gesten der täglichen Interaktion finden sich die Seelenregungen abgeleitet, die jedes der vorgestellten Exemplare bestimmen, und wo die Deduktion eines Traumas im Text lückenhaft ist, da besorgt die Nuancierung des Vortrags den nächsten Schritt der Verständnisses. "Der Ohrenzeuge" ist ein Hörbuch für Freudianer, weil es dem Ausspruch, daß "nichts als Verdrängung" "dahinterstehe", auf eine Art und Weise Rechnung trägt, die ihn nicht mehr diskutabel, wie er es als (nunmehr populär)wissenschaftliche These war, sondern als Ferment eines literarischen Werkes absolutiert erscheinen lassen, gültig als bestimmendes Weltgesetz zumindest innerhalb dieses einen Werkes. Man mag, von außen, anmerken, es handle sich nicht um die Porträts von Menschen, sondern um Spekulation über psychische Bedingtheiten angesichts einer Momentaufnahme, deren Verzerrungen konsequent zu Ende gedacht sind. "Objektiv" trifft dieser Vorwurf, oder besser gesagt, entspräche die Psychologie des "Ohrenzeugen" eins zu eins der Psychologie des Homo Sapiens, dann wäre die Welt ein noch undankbarer Platz zum Leben, als sie es ohnehin schon ist. Literatur jedoch hat weder die Aufgabe noch das Instrumentarium, von der "Wahrheit" zu sprechen. Ihr Feld ist der Erkenntnisprozess als solcher. Und diesem Feld ist die Beobachtungsweise Canettis (ganz zu schweigen von ihrer Interpretation durch die beiden Lesenden) angemessen. Viel besser und viel verbrauchergerechter, als dies jede wortreiche Beschreibung meinerseits könnte, veranschaulicht der Klappentext der CD, entnommen einer FAZ-Rezension, worum es im "Ohrenzeugen" geht und worauf der Hörer sich einzustellen habe: Originalbeitrag Stefan Schmitzer |
| Veranstaltungen |
|
Junge LiteraturhausWerkstatt
Mo, 05.02. bis Mi, 07.02.2018, 15.00–19.00 Uhr Dreitägiger Schreibworkshop für...
Verleihung der Ăśbersetzerpreise der Stadt Wien 2016 & 2017
Do, 08.02.2018, 19.00 Uhr Preisverleihung & Lesung Der mit € 3.700 dotierte Übersetzerpreis... |
| Ausstellung |
| Tipp |
|
flugschrift Nr. 21 – MARK Z. DANIELEWSKI
Dem amerikanischen Autor Mark Z. Danielewski gelang es mit seinem Roman-Debut Das... |
|
Incentives – Austrian Literature in Translation
Neue Beiträge zu Clemens Berger, Sabine Gruber, Peter Henisch, Reinhard Kaiser-Mühlecker, Barbi... |