- Das Haus
- Newsletter
- Service
- Publikationen
- Veranstaltungen
- NEU Livestream
- Ausstellungen
- Buchmagazin & AutorInnen
- AutorInnen
- AUFTRITTE
- Rezensionen Buch
- Rezensionen 2019
- Rezensionen 2018
- Rezensionen 2017
- Rezensionen 2016
- Rezensionen 2015
- Rezensionen 2014
- Rezensionen 2013
- Pressespiegel 2000-2010
- AutorInnen A
- AutorInnen B
- AutorInnen C
- AutorInnen D
- Autorinnen E
- AutorInnen F
- AutorInnen G
- AutorInnen H
- AutorInnen I
- AutorInnen J
- AutorInnen K
- AutorInnen L
- AutorInnen M
- AutorInnen N
- AutorInnen O
- AutorInnen P
- AutorInnen Q
- AutorInnen R
- AutorInnen S
- AutorInnen T
- AutorInnen U
- AutorInnen V
- AutorInnen W
- AutorInnen Z
- Incentives
- Rezensionen Sachbuch
- Verlage
- Dank an Verlage
- Impressum
- Bibliothek & Sammlungen
- Katalogsuche
- Partnerinstitutionen

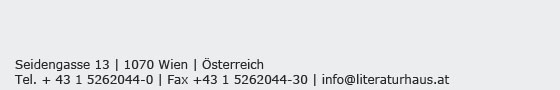
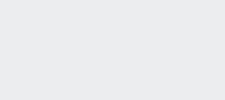


FÖRDERGEBER
PARTNER/INNEN

Leseprobe: Franz Josef Czernin - Das telepathische LammTod durch Musen (Friederike Mayröcker)
Auch davon träumen alle, die dichten: die Grenzen ihrer selbst als die Grenzen ihres Daseins zu erfahren und die Grenzen ihres Dichtens über alle Maßen auszudehnen, auf dass das Spiel, und auch der Ernst, zwischen Ermächtigung und Preisgabe bis zum letzten Tropfen ausgekostet werden kann. (S. 23) © 2011 Klever Verlag, Wien.
|
| Veranstaltungen |
|
Junge LiteraturhausWerkstatt - online
Mi, 13.01.2021, 18.00–20.00 Uhr online-Schreibwerkstatt für 14- bis 20-Jährige Du schreibst und...
Grenzenlos? (Literaturedition Niederösterreich, 2020) - online
Do, 14.01.2021, 19.00 Uhr Buchpräsentation mit Lesungen Die Veranstaltung kann über den Live... |
| Ausstellung |
|
Claudia Bitter – Die Sprache der Dinge
14.09.2020 bis 25.02.2021 Seit rund 15 Jahren ist die Autorin Claudia Bitter auch bildnerisch... |
| Tipp |
|
LITERATUR FINDET STATT
Eigentlich hätte der jährlich erscheinende Katalog "DIE LITERATUR der österreichischen Kunst-,... |
|
OUT NOW flugschrift Nr. 33 von GERHARD RĂśHM
Die neue Ausgabe der flugschrift des in Wien geborenen Schriftstellers, Komponisten und bildenden... |