- Das Haus
- Newsletter
- Service
- Publikationen
- Veranstaltungen
- NEU Livestream
- Ausstellungen
- Buchmagazin & AutorInnen
- AutorInnen
- AUFTRITTE
- Rezensionen Buch
- Rezensionen 2019
- Rezensionen 2018
- Rezensionen 2017
- Rezensionen 2016
- Rezensionen 2015
- Rezensionen 2014
- Rezensionen 2013
- Pressespiegel 2000-2010
- AutorInnen A
- AutorInnen B
- AutorInnen C
- AutorInnen D
- Autorinnen E
- AutorInnen F
- AutorInnen G
- AutorInnen H
- AutorInnen I
- AutorInnen J
- AutorInnen K
- AutorInnen L
- AutorInnen M
- AutorInnen N
- AutorInnen O
- AutorInnen P
- AutorInnen Q
- AutorInnen R
- AutorInnen S
- AutorInnen T
- AutorInnen U
- AutorInnen V
- AutorInnen W
- AutorInnen Z
- Incentives
- Rezensionen Sachbuch
- Verlage
- Dank an Verlage
- Impressum
- Bibliothek & Sammlungen
- Katalogsuche
- Partnerinstitutionen

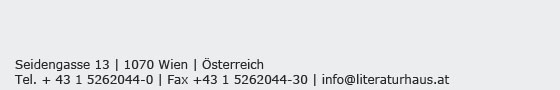
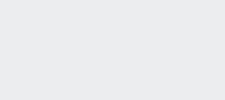


FÖRDERGEBER
PARTNER/INNEN

Leseprobe: Brigitta Falkner - Populäre Panoramen I  Im Gegensatz zu dem, was sich ereignet, wenn wir eine Sache oder ein Wesen in seiner wirklichen Größe zu erkennen suchen, geht im verkleinerten Modell die Erkenntnis des Ganzen der der Teile voraus. Und selbst wenn das eine Illusion ist, liegt der Sinn dieses Vorganges darin, diese Illusion zu schaffen oder aufrechtzuerhalten, die sowohl dem Verstand wie den Sinnen ein Vergnügen bietet, das schon auf dieser Basis allein ästhetisch genannt werden kann. Claude Lévi-Strauss (S. 6)
Aus dem Nachbarabteil dringt ein Geräusch, als würden Flügel gegen eine Scheibe schlagen. Da dreht mein Gegenüber das Gesicht zur Sonne und blinzelt. Blitzschnell schrumpft die Banane in seiner Faust und verschwindet in seinem Mund. Der Kopf sackt langsam zur Seite. Zwei Sitze weiter blickt die Frau von ihrem Buch auf. Wir nähern uns einem brummenden Transformatorenhäuschen. Der Mann am Fenster hat die Augen geschlossen. Mit dem Daumennagel schrubbt er über das Lüftungsgitter als wärs das Griffbrett einer Gitarre. Die Räder quietschen in den Kurven. Kaum Geräusche macht dagegen die Frau. Die linke Hand liegt schlaff auf dem Sitz, während ihre Augen über die Zeilen ruckeln. Manchmal bewegt sie die Lippen oder schiebt die Zunge dazwischen und befeuchtet die Fingerkuppen mit Spucke. Dann blättert sie um, fährt mit dem Finger den Falz entlang und schaut dabei auf, wie es Vortragende tun. Jetzt fährt der Zug im Schritttempo. Der Bach schimmert silbrig wie ein riesiger Fisch. Ein Vogel plumpst ins Wasser. Über den Wipfeln wummern die Rotorblätter eines Hubschraubers. „Ist das Ihrer?“ fragt die Frau, indem sie den mit Speichel benetzten Finger auf einen roten Kuli richtet, der klackernd über das Tischchen rollt. Nein, sage ich. Bitte, sagt mein Gegenüber, als der Kuli an der Kante zum Stillstand kommt, greift danach und reicht ihn der Frau. Feiner Sand rieselt aus dem Ärmel. (S. 102 ff.)
Die Frau mustert ihn von der Seite, das vorgstreckte Kinn zittert leicht. Bläulicher Speichel tropft aus den Mundwinkeln, die im nächsten Augenblick, als mein Gegenüber das Gesicht verzieht, laut gähnend das Maul aufreißt, die kurzen Beine von sich streckt und das gestaute Blut durch die Venen rauschen lässt, zu zucken beginnen, zunächst zart, dann immer heftiger, was auf eine gesteigerte Aktivität der Spiegelneuronen schließen lässt, mein Gegenüber indes als Missbilligung deutet und halb gähnend, halb lächelnd, mit einem Zucken der Schultern erwidert, worauf die Frau nun verhalten gähnend lächelt und dabei die Nasenflügel bläht, als wittere sie etwas, während ich keine Miene verziehe, die beiden beobachte und beim Anblick der aufgesperrten Mäuler und Nüstern an zwei Hunde denken muss, sowie an eine, aufgrund der Manipulierbarkeit dieser Spezies häufig gemachte Beobachtung, wonach auch Hunde sich vom Gähnen ihrer Besitzer anstecken lassen, das Gähnen sich gelegentlich aber auch umgekehrt von den Vierbeinern auf ihre Besitzer – die „Zweibeiner ohne Federn“, wie Platon seinesgleichen umschrieb – überträgt, mit dem Unterschied, dass typisch menschliches Verhalten bei Hunden oft als drollig, hündisches Verhalten bei Menschen jedoch nie als niedlich empfunden wird. Befremdlich wirkt auch lautes, bellendes Gelächter, während sprechende Hunde – wiewohl nicht weniger verstörend – als lustig, ja sympathisch gelten. Zuweilen begegnet man ihnen in Filmen, seltener in Träumen. Nichts Beunruhigendes finden wir an bewegten Bildern von Klavier spielenden oder Auto fahrenden Hunden, wohl aber an der Vorstellung, dass der Schwanz mit dem Hund wedelt. In Entenhausen, wo auffällig mehr Hunde als Enten hausen, bewegen und kleiden sich die Hunde wie Menschen, spazieren auf zwei Beinen, die in Hosen stecken, während sie ihre nackten Artgenossen an der Leine führen. (S. 196 ff.) © 2010 Klever Verlag, Wien.
|
| Veranstaltungen |
|
Junge LiteraturhausWerkstatt - online
Mi, 13.01.2021, 18.00–20.00 Uhr online-Schreibwerkstatt für 14- bis 20-Jährige Du schreibst und...
Grenzenlos? (Literaturedition Niederösterreich, 2020) - online
Do, 14.01.2021, 19.00 Uhr Buchpräsentation mit Lesungen Die Veranstaltung kann über den Live... |
| Ausstellung |
|
Claudia Bitter – Die Sprache der Dinge
14.09.2020 bis 25.02.2021 Seit rund 15 Jahren ist die Autorin Claudia Bitter auch bildnerisch... |
| Tipp |
|
LITERATUR FINDET STATT
Eigentlich hätte der jährlich erscheinende Katalog "DIE LITERATUR der österreichischen Kunst-,... |
|
OUT NOW flugschrift Nr. 33 von GERHARD RĂśHM
Die neue Ausgabe der flugschrift des in Wien geborenen Schriftstellers, Komponisten und bildenden... |