- Das Haus
- Newsletter
- Service
- Publikationen
- Veranstaltungen
- NEU Livestream
- Ausstellungen
- Buchmagazin & AutorInnen
- AutorInnen
- AUFTRITTE
- Rezensionen Buch
- Rezensionen 2019
- Rezensionen 2018
- Rezensionen 2017
- Rezensionen 2016
- Rezensionen 2015
- Rezensionen 2014
- Rezensionen 2013
- Pressespiegel 2000-2010
- AutorInnen A
- AutorInnen B
- AutorInnen C
- AutorInnen D
- Autorinnen E
- AutorInnen F
- AutorInnen G
- AutorInnen H
- AutorInnen I
- AutorInnen J
- AutorInnen K
- AutorInnen L
- AutorInnen M
- AutorInnen N
- AutorInnen O
- AutorInnen P
- AutorInnen Q
- AutorInnen R
- AutorInnen S
- AutorInnen T
- AutorInnen U
- AutorInnen V
- AutorInnen W
- AutorInnen Z
- Incentives
- Rezensionen Sachbuch
- Verlage
- Dank an Verlage
- Impressum
- Bibliothek & Sammlungen
- Katalogsuche
- Partnerinstitutionen

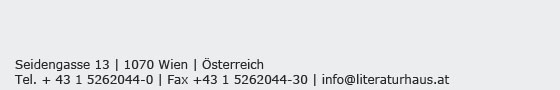
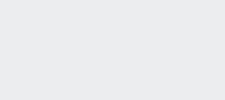


FÖRDERGEBER
PARTNER/INNEN

Leseprobe: Andreas Unterweger - "Wie im Siebenten." Damals schrieb ich immer am Fensterbrett. Morgen für Morgen, nachdem Judith, was immer schon sehr früh am Morgen war, das Zimmer verlassen hatte, öffnete ich das Fenster, das zum Innenhof ging, und setzte mich dort aufs Fensterbrett, um zu schreiben. Morgen für Morgen baute ich dort, am Fensterbrett, aufs Neue ein Schreibnest – mein Nest, in dem außer mir nicht viel Platz zu haben brauchte: nur der Teller mit dem Nutellabrot, die Tasse Kaffee (ganz schwarz, mit Honig) und mein Schreibblock. © 2009 Literaturverlag Droschl, Graz-Wien.
|
| Veranstaltungen |
|
Grenzenlos? (Literaturedition Niederösterreich, 2020) - online
Do, 14.01.2021, 19.00 Uhr Buchpräsentation mit Lesungen Die Veranstaltung kann über den Live...
Super LeseClub mit Diana Köhle & David Samhaber - online
Mo, 18.01.2021, 18.30-20.30 Uhr online-Leseclub fĂĽr Leser/innen von 15 bis 22 Jahren Anmeldung... |
| Ausstellung |
|
Claudia Bitter – Die Sprache der Dinge
14.09.2020 bis 25.02.2021 Seit rund 15 Jahren ist die Autorin Claudia Bitter auch bildnerisch... |
| Tipp |
|
LITERATUR FINDET STATT
Eigentlich hätte der jährlich erscheinende Katalog "DIE LITERATUR der österreichischen Kunst-,... |
|
OUT NOW flugschrift Nr. 33 von GERHARD RĂśHM
Die neue Ausgabe der flugschrift des in Wien geborenen Schriftstellers, Komponisten und bildenden... |