- Das Haus
- Newsletter
- Service
- Publikationen
- Veranstaltungen
- Ausstellungen
- Buchmagazin & AutorInnen
- Ă–sterreichische AutorInnen
- AUFTRITTE
- Rezensionen Buch
- Incentives
- Rezensionen Sachbuch
- Neuerscheinungen
- Alle Rezensionen seit 1997
- AutorInnen A
- AutorInnen B
- AutorInnen C
- AutorInnen D
- AutorInnen E
- AutorInnen F
- AutorInnen G
- AutorInnen H
- AutorInnen I
- AutorInnen J
- AutorInnen K
- AutorInnen L
- AutorInnen M
- AutorInnen N
- AutorInnen O
- AutorInnen P
- AutorInnen Q
- AutorInnen R
- AutorInnen S
- AutorInnen T
- AutorInnen U
- AutorInnen V
- AutorInnen W
- AutorInnen Y
- AutorInnen Z
- Rezensionen Hörbuch
- Interviews / Portraits
- Verlage
- Dank an Verlage
- Impressum
- Bibliothek & Sammlungen
- Katalogsuche
- Museen, Festivals & Reisen
- Preise, Projekte, Archive, Tagungen, Akademien
- Literaturhäuser
- Partner

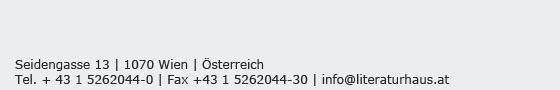
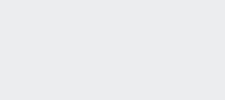
FÖRDERGEBER

PARTNER/INNEN

Klaus Hödl (Hrsg.): Jüdische Identitäten. Einblicke in die Bewusstseinslandschaft des österreichischen Judentums.Studien Verlag 2000. Was Jüdischsein sei, wes Geistes, wes Wesens das Judentum wäre: So fragte das wissenschaftsfröhliche 19. Jahrhundert und setzte die Diskursdampfmaschinen von Medizin und Abstammungslehre, von Anthropologie und Psychiatrie in Gang, um mit Diagnosen, Daten und Denuniziationen jenen kleinen Unterschied festzustellen, welcher vermutlich zwischen den Assimilierten und den "eigenen Leuten" bestand. Heute sind es die Kulturwissenschafter, welche nach solchen Unterschieden oder - moderner formuliert - nach diskurshistorischen "Konstruktionen von Differenzen" tasten. Mit einem Sammelband über "Jüdische Identitäten" tritt nun das kürzlich an der Grazer Universität etablierte David Herzog Centrum für Jüdische Studien (DHC) auf den Plan und schickt sich an, das weite Land zwischen den fraglichen Kategorien von Religion, Nation, "Volk" , "Rasse" und Soziokultur zu vermessen. "Ja" , deklariert der fachkundige Historiker Steven Beller (und widerspricht damit der individualistischen These Ernst H. Gombrichs), es gebe diesen - eben gar nicht so kleinen - Unterschied des Jüdischseins, welcher etwa den phänomenal hoch proportionierten Anteil jüdischer Künstler und Intellektueller an der Leistungsbilanz der Moderne erkläre. Im Zweifelsfall, so fand die zeitgenössische psychiatrische Medizin eine probate und meist pejorativ applizierte Diagnose, war das produktive Anderssein auf die "jüdische Nervosität" reduzibel. Mehrere Beiträge des Bandes bestätigen mit Fallstudien Sander L. Gilmans berühmte These über die Isotopie der ängstlichen Vorurteile gegenüber dem "semitischen Hysteriker" einerseits und dem frauenbewegten "Mannweib" zum andern. Eine exzellente Alternative zu dieser - in ihren Trivialisierungen oft auf die Formel "Jude = Frau = Opfer" reduzierten - Perspektive liefert Georg Hofer mit seiner dankenswert klaren Darstellung der einigermassen kontradiktorischen Geschichte des Diagnosesyndroms Neurasthenie : Egon Friedell war nicht der Einzige , der das vermeintliche Dekadenz-Indiz als "Symptom gesteigerter Gesundheit und Lebenskraft" zu deuten geneigt war.
Christiane Zintzen Zuerst erschienen in: NZZ, 6. 8. 2001.
|
| Veranstaltungen |
|
Junge LiteraturhausWerkstatt
Mo, 05.02. bis Mi, 07.02.2018, 15.00–19.00 Uhr Dreitägiger Schreibworkshop für...
Verleihung der Ăśbersetzerpreise der Stadt Wien 2016 & 2017
Do, 08.02.2018, 19.00 Uhr Preisverleihung & Lesung Der mit € 3.700 dotierte Übersetzerpreis... |
| Ausstellung |
| Tipp |
|
flugschrift Nr. 22 – Paul Divjak
Mit Rebranding flugschrift greift der Autor und KĂĽnstler Paul Divjak das Thema von... |
|
Incentives – Austrian Literature in Translation
Neue Beiträge zu Clemens Berger, Sabine Gruber, Peter Henisch, Reinhard Kaiser-Mühlecker, Barbi... |