- Das Haus
- Newsletter
- Service
- Publikationen
- Veranstaltungen
- Livestream
- Livestream-Archiv
- Ausstellungen
- Buchmagazin & AutorInnen
- AutorInnen
- AUFTRITTE
- Rezensionen Buch
- Rezensionen 2021
- Rezensionen 2020
- Rezensionen 2019
- Rezensionen 2018
- Rezensionen 2017
- Rezensionen 2016
- Rezensionen 2015
- Rezensionen 2014
- Rezensionen 2013
- Pressespiegel 2000-2010
- AutorInnen A
- AutorInnen B
- AutorInnen C
- AutorInnen D
- Autorinnen E
- AutorInnen F
- AutorInnen G
- AutorInnen H
- AutorInnen I
- AutorInnen J
- AutorInnen K
- AutorInnen L
- AutorInnen M
- AutorInnen N
- AutorInnen O
- AutorInnen P
- AutorInnen Q
- AutorInnen R
- AutorInnen S
- AutorInnen T
- AutorInnen U
- AutorInnen V
- AutorInnen W
- AutorInnen Z
- Rezensionen Sachbuch
- Verlage
- Dank an Verlage
- Impressum
- Incentives
- Bibliothek & Sammlungen
- Katalogsuche
- Partnerinstitutionen

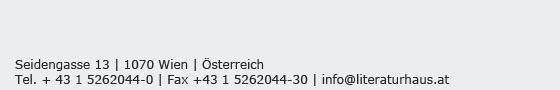
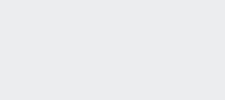


FÖRDERGEBER
PARTNER/INNEN

Eva Menasse: DunkelblumLeseprobe:In Dunkelblum haben die Mauern Ohren, die Blüten in den Gärten haben Augen, sie drehen ihre Köpfchen hierhin und dorthin, damit ihnen nichts entgeht, und das Gras registriert mit seinen Schnurrhaaren jeden Schritt. Die Menschen haben immerzu ein Gespür. Die Vorhänge im Ort bewegen sich wie von leisem Atem getrieben, ein und aus, lebensnotwendig. Jedes Mal, wenn Gott von oben in diese Häuser schaut, als hätten sie gar keine Dächer, wenn er hineinblickt in die Puppenhäuser seines Modellstädtchens, das er zusammen mit dem Teufel gebaut hat zur Mahnung an alle, dann sieht er in fast jedem Haus welche, die an den Fenstern hinter ihren Vorhängen stehen und hinausspähen. Manchmal, oft, stehen auch zwei oder sogar drei im selben Haus an den Fenstern, in verschiedenen Räumen und voreinander verborgen. Man wünschte Gott, dass er nur in die Häuser sehen könnte und nicht in die Herzen. © 2021 Kiepenheuer & Witsch
|
| Veranstaltungen |
|
edition exil entdeckt – Zarah Weiss blasse tage (edition exil, 2022) Ganna Gnedkova & Ana Drezga
Fr, 04.11.2022, 19.00 Uhr Neuerscheinungen Herbst 2022 mit Buchpremiere | unveröffentlichte Texte...
"Im Westen viel Neues" mit Kadisha Belfiore | Nadine Kegele | Tobias March | Amos Postner | Maya Rinderer
Mo, 07.11.2022, 19.00 Uhr Lesungen, Film & Musik Die Reihe "Im Westen viel Neues" stellt... |
| Ausstellung |
|
"Ah! THOMAS BERNHARD. Den kenn ich. – Schreibt der jetzt für Sie?"
Nicolas Mahler zeichnet Artmann, Bernhard, Jelinek, Musil & Joyce 17.09. bis 14.12.2022 Er ist der erste, der im renommierten deutschen Literaturverlag Suhrkamp... |
| Tipp |
|
OUT NOW : flugschrift Nr. 40 - Valerie Fritsch
gebt mir ein meer ohne ufer Nr. 40 der Reihe flugschrift - Literatur als Kunstform und Theorie... |
|
INCENTIVES - AUSTRIAN LITERATURE IN TRANSLATION
Buchtipps zu Kaska Bryla, Doron Rabinovici und Sabine Scholl auf Deutsch, Englisch, Französisch,... |