- Das Haus
- Newsletter
- Service
- Publikationen
- Veranstaltungen
- Ausstellungen
- Buchmagazin & AutorInnen
- Ă–sterreichische AutorInnen
- AUFTRITTE
- Rezensionen Buch
- Pressespiegel 2000-2010
- AutorInnen A
- AutorInnen B
- AutorInnen C
- AutorInnen D
- Autorinnen E
- AutorInnen F
- AutorInnen G
- AutorInnen H
- AutorInnen I
- AutorInnen J
- AutorInnen K
- AutorInnen L
- AutorInnen M
- AutorInnen N
- AutorInnen O
- AutorInnen P
- AutorInnen Q
- AutorInnen R
- AutorInnen S
- AutorInnen T
- AutorInnen U
- AutorInnen V
- AutorInnen W
- AutorInnen Z
- Incentives
- Rezensionen Sachbuch
- Rezensionen Hörbuch
- Interviews / Portraits
- Verlage
- Dank an Verlage
- Impressum
- Bibliothek & Sammlungen
- Katalogsuche
- Museen, Festivals & Reisen
- Preise, Projekte, Archive, Tagungen, Akademien
- Literaturhäuser
- Partner



FÖRDERGEBER

PARTNER/INNEN

 Peter Henisch: Suchbild mit Katze.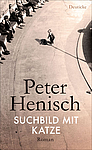 Leseprobe: All die Fenster, aus denen ich schon geschaut habe. Nicht ganz wenige im Lauf eines Lebens. Die meisten in Wien und Umgebung, ein paar auch woanders. Fenster mit Blick ins Grüne oder ins Graue, Fenster mit und ohne Meerblick. Das Fenster, das mir zuallererst einfällt, ist aber das Erkerfenster im dritten Bezirk. Adresse: Wien III, Keinergasse 11, Ecke Hainburger Straße. Dort war die Wohnung, in der mein Bewusstsein erwacht ist. Was früher war, in meinen ersten zwei, drei Jahren, ist sehr dunkel. (Über den ersten Schultag) "Warum hat er geweint? War die Aussicht, von nun an die meisten Vormittage unter so vielen Kindern verbringen zu müssen, zum Heulen? So fern von Erwachsenen, mit denen er erfahrungsgemäß viel besser umgehen konnte? Im Hintergrund wahrscheinlich die Unsicherheit darüber, wie diese Kinder ihn finden würden. Die bange Frage, ob sie ihn, der sich unter ihnen fremd fühlte, akzeptieren würden, oder eben nicht, weil sie ihm diese Fremdheit ansahen. (S. 116f.)
|
| Veranstaltungen |
|
Junge LiteraturhausWerkstatt
Mo, 05.02. bis Mi, 07.02.2018, 15.00–19.00 Uhr Dreitägiger Schreibworkshop für...
Verleihung der Ăśbersetzerpreise der Stadt Wien 2016 & 2017
Do, 08.02.2018, 19.00 Uhr Preisverleihung & Lesung Der mit € 3.700 dotierte Übersetzerpreis... |
| Ausstellung |
| Tipp |
|
flugschrift Nr. 22 – Paul Divjak
Mit Rebranding flugschrift greift der Autor und KĂĽnstler Paul Divjak das Thema von... |
|
Incentives – Austrian Literature in Translation
Neue Beiträge zu Clemens Berger, Sabine Gruber, Peter Henisch, Reinhard Kaiser-Mühlecker, Barbi... |