- Das Haus
- Newsletter
- Service
- Publikationen
- Veranstaltungen
- Ausstellungen
- Buchmagazin & AutorInnen
- Ă–sterreichische AutorInnen
- AUFTRITTE
- Rezensionen Buch
- Pressespiegel 2000-2010
- AutorInnen A
- AutorInnen B
- AutorInnen C
- AutorInnen D
- Autorinnen E
- AutorInnen F
- AutorInnen G
- AutorInnen H
- AutorInnen I
- AutorInnen J
- AutorInnen K
- AutorInnen L
- AutorInnen M
- AutorInnen N
- AutorInnen O
- AutorInnen P
- AutorInnen Q
- AutorInnen R
- AutorInnen S
- AutorInnen T
- AutorInnen U
- AutorInnen V
- AutorInnen W
- AutorInnen Z
- Incentives
- Rezensionen Sachbuch
- Rezensionen Hörbuch
- Interviews / Portraits
- Verlage
- Dank an Verlage
- Impressum
- Bibliothek & Sammlungen
- Katalogsuche
- Museen, Festivals & Reisen
- Preise, Projekte, Archive, Tagungen, Akademien
- Literaturhäuser
- Partner

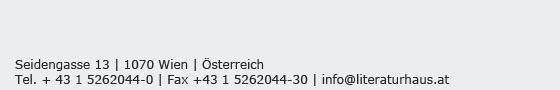
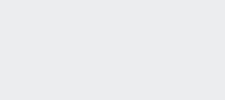
FÖRDERGEBER

PARTNER/INNEN

Leseprobe: Ludwig Fels - "Die Parks von Palilula." Es sind einige maßlos wilde, harte Jahre vergangen, seit B., Udokas Mutter, nach Wien kam. Als wir uns kennenlernten, erzählte sie mir, sie sei vor ein paar Tagen oder Wochen am Stadtrand von Wien von einem Lastzug gesprungen und habe sich im Gebüsch versteckt, bis der Lastzug weitergefahren wäre. Die Wege dieser Menschen, sie erklären sich nicht, bleiben sorgsam gehütete Geheimnisse; sogar die Entfernungen sind nicht so einfach umkehrbar, denn von Afrika nach hierher dauert es wesentlich länger als von hier zurück nach Afrika. Ein andermal kam sie mit dem Flugzeug, dann wieder mit dem Schiff, ist gewandert, geflogen. Es spielt keine Rolle. Warum soll sie jemand anderem mehr glauben als sich selbst? © 2009 Jung und Jung, Salzburg.
|
| Veranstaltungen |
|
Junge LiteraturhausWerkstatt
Mo, 05.02. bis Mi, 07.02.2018, 15.00–19.00 Uhr Dreitägiger Schreibworkshop für...
Verleihung der Ăśbersetzerpreise der Stadt Wien 2016 & 2017
Do, 08.02.2018, 19.00 Uhr Preisverleihung & Lesung Der mit € 3.700 dotierte Übersetzerpreis... |
| Ausstellung |
| Tipp |
|
flugschrift Nr. 21 – MARK Z. DANIELEWSKI
Dem amerikanischen Autor Mark Z. Danielewski gelang es mit seinem Roman-Debut Das... |
|
Incentives – Austrian Literature in Translation
Neue Beiträge zu Clemens Berger, Sabine Gruber, Peter Henisch, Reinhard Kaiser-Mühlecker, Barbi... |