- Das Haus
- Newsletter
- Service
- Publikationen
- Veranstaltungen
- NEU Livestream
- Ausstellungen
- Buchmagazin & AutorInnen
- AutorInnen
- AUFTRITTE
- Rezensionen Buch
- Rezensionen 2019
- Rezensionen 2018
- Rezensionen 2017
- Rezensionen 2016
- Rezensionen 2015
- Rezensionen 2014
- Rezensionen 2013
- Pressespiegel 2000-2010
- AutorInnen A
- AutorInnen B
- AutorInnen C
- AutorInnen D
- Autorinnen E
- AutorInnen F
- AutorInnen G
- AutorInnen H
- AutorInnen I
- AutorInnen J
- AutorInnen K
- AutorInnen L
- AutorInnen M
- AutorInnen N
- AutorInnen O
- AutorInnen P
- AutorInnen Q
- AutorInnen R
- AutorInnen S
- AutorInnen T
- AutorInnen U
- AutorInnen V
- AutorInnen W
- AutorInnen Z
- Incentives
- Rezensionen Sachbuch
- Verlage
- Dank an Verlage
- Impressum
- Bibliothek & Sammlungen
- Katalogsuche
- Partnerinstitutionen

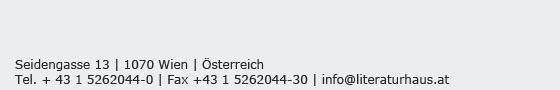
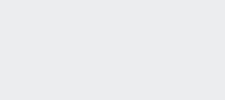


FÖRDERGEBER
PARTNER/INNEN

Sandra Gugic: Zorn und Stille.Leseproben:I. Billy, September 2016 Der Pass, den ich über das Pult schob, war mein guter Pass, mein A-Land-Pass, damit war ich überall willkommen, weitgehend visafrei, und wenn nicht, stellte auch das kein Problem dar, dabei hätte ich diesmal den anderen nehmen können, den ich noch nie verwendet hatte, meinen serbischen Pass. Aus einem diffusen Schuldbewusstsein heraus konnte ich den unnützen Pass nicht seinem Ablaufdatum überlassen, hatte ich ihn trotzdem jedes Mal wieder verlängern lassen. Ich musste an den Konsulatsbeamten denken, der mich auf mein Zögern, eine seiner Fragen zu beantworten – mein Zögern, das nichts weiter war als ein Suchen, ein Tasten nach den richtigen Worten in dieser Sprache, weil ich die Sätze zuerst auf Deutsch dachte, nicht anders denken konnte –, gefragt hatte: Verstehen Sie nicht, oder wollen Sie nicht verstehen? An einem Herbsttag im holzvertäfelten Erdgeschoss der serbischen Botschaft im Grunewald, an den Wänden vergilbte Poster der Tourismuswerbung, die sich an den Ecken widerspenstig aufrollten. Ein Plakat zeigte den Rtanj, eine Gebirgskette aus Kalkstein, Schiefer, Sandstein und Dolomit, umgeben von Tannen, Buchen und Wiesen, der höchste Punkt des Massivs hatte die Form einer dreiseitigen Pyramide. Ich war nie da gewesen, aber Vater hatte mir davon erzählt, sein Rtanj, hatte er gesagt, dort war er gewandert als junger Mann, diese Wanderungen waren seine ersten Reisebewegungen gewesen. Mein alter Pass lag auf dem Schreibtisch des Konsulatsbeamten, und während er seiner Kollegin im Nebenzimmer zurief, dass hier vor ihm Eine von uns säße, fiel mir das erste Mal auf, dass auf dem Deckel meines blauen, 2005 ausgestellten, 2015 abgelaufenen Passes in kyrillischer Schrift Savezna Republika Jugoslavija–Bundesrepublik Jugoslawien stand. Dabei war die Bundesrepublik Jugoslawien 2003 in die Staatenunion Serbien-Montenegro umgewandelt worden, drei Jahre später löste sich die Staatenunion auf, Montenegro wurde unabhängig. Hatten die Mitarbeiter der serbischen Botschaft damals die Überreste des untergegangenen Landes im Passlager kreativ verwertet? – Enjoy your flight, das routinierte Lächeln der Frau hinter dem Schalter, die Stimmen aus den Lautsprechern wiederholten ihr tägliches Mantra: Dear passengers, please proceed to. Ich stellte mir vor, wie meine Mutter am Check-in-Schalter in Wien alle fünf Minuten mit nervösen kleinen Bewegungen den Inhalt ihrer Handtasche kontrollierte, sie hatte sich für die Reise zurechtgemacht, aber nichts schien am rechten Platz zu sein, die Frisur war heute morgen nicht in Form zu bringen gewesen, das Make-up war hastig aufgetragen und jetzt schon in die Linien unter ihren Augen und um ihre Mundwinkel verlaufen, ihre Finger glitten über einen raschelnden Teppich aus Bonbonverpackungen, ein Kugelschreiber blutete Farbe in das Innenfutter, etwas Blau blieb an ihrem Zeigefinger haften, dann ertastete sie ihr Ticket und atmete erleichtert aus, während der Sarg meines Vaters in den Bauch eines Flugzeugs glitt. Ich kannte das genaue Prozedere, ich hatte die nötigen Anrufe gemacht, die Richtigkeit aller Abläufe geprüft, aber alles in die Wege geleitet hatte mein Vater selbst, schon vor Jahren war er mit dem Mitarbeiter des Bestattungsunternehmens jede Etappe seiner letzten Reise durchgegangen, er hatte auf einer Tour bestanden, von den Arbeitsschritten in der Aufbahrungshalle bis zum Verladevorgang hatten sie alles durchexerziert, Vater wollte genau über diese letzte Reise Bescheid wissen, die ihn an den Ausgangspunkt, den er Heimat nannte, zurückbringen sollte. Es gab sogar ein launiges Video von dieser Tour. Ich weiß nicht, wer hinter der Kamera gestanden hatte. Im Video grinsten er und der junge Bestattungsunternehmer unaufhörlich, Vater strahlte eine kindliche Freude aus, beiden machte die Tour offensichtlich großen Spaß. Wie oft hatte ich ihn so fröhlich gesehen? Mein Vater war sein Leben lang bemüht, sein Gesicht nicht zu verlieren, hatte sich in Zurückhaltung geübt, sein Lachen war meist verhalten, auch sein Zorn war still, nach innen gerichtet, die kindliche Ausgelassenheit, die er auf den Bildern ausstrahlte, war mir fremd. (S. 9-10) Als wir Kinder waren, waren wir keine Kinder. Nicht so wie alle anderen. Jonas Nevens Rückkehr in mein Leben stellte mich in Frage. Ich hatte früh gelernt, die jeweiligen gesellschaftlichen Codes für mich zu adaptieren, ohne mich wirklich anzupassen, hatte mir angewöhnt, mein Gegenüber auf Distanz zu halten, viel gesprochen hatte ich nie. Und obwohl ich als Kind aufs Lesen versessen war, schrieb ich nie etwas auf, letztlich schien mir die Sprache ungeeignet, ich versuchte, mir die Welt über die Bilder zu entschlüsseln. Ich betrachtete das Gesicht meines Bruders. Seine Züge, seine Gesten waren weder meinem Vater noch meiner Mutter eindeutig zuzuordnen, sie changierten zwischen diesen beiden Menschen. Ich glich eindeutig meinem Vater, der schmale, sehnige Körper, die Struktur meiner Knochen, meines Gesichts, meine schweren Locken. Die Züge meiner Mutter waren weicher, aber dennoch markant, sie hasste den Höcker auf ihrer langen, schmalen Nase, dabei war er wunderschön. Vater, Mutter und ich hatten dunkles Haar und blasse Haut. Das helle Haar, die wasserblauen Augen und der leicht gelbliche Teint, der im Sommer rasch tiefbraun wurde, waren nur meinem Bruder eigen. Schön war er, ohne Zweifel, auf eine zerbrechliche, beinahe melancholische Art. Ich sah ihn an und war mir sicher, je mehr er unsere gemeinsame Geschichte in Erinnerung wachrufen und konservieren wollte, desto eher würden wir uns in gegenseitiger Enttäuschung wiederfinden. Die Verbindung zwischen Jonas Neven und mir war nach wie vor stark, aber ebenso gefärbt von den Jahren des Wartens seinerseits und, was mich betraf, des Weitermachens. (S. 88f) © 2020 Hoffmann und Campe, Hamburg
|
| Veranstaltungen |
|
Junge LiteraturhausWerkstatt - online
Mi, 13.01.2021, 18.00–20.00 Uhr online-Schreibwerkstatt für 14- bis 20-Jährige Du schreibst und...
Grenzenlos? (Literaturedition Niederösterreich, 2020) - online
Do, 14.01.2021, 19.00 Uhr Buchpräsentation mit Lesungen Die Veranstaltung kann über den Live... |
| Ausstellung |
|
Claudia Bitter – Die Sprache der Dinge
14.09.2020 bis 25.02.2021 Seit rund 15 Jahren ist die Autorin Claudia Bitter auch bildnerisch... |
| Tipp |
|
LITERATUR FINDET STATT
Eigentlich hätte der jährlich erscheinende Katalog "DIE LITERATUR der österreichischen Kunst-,... |
|
OUT NOW flugschrift Nr. 33 von GERHARD RĂśHM
Die neue Ausgabe der flugschrift des in Wien geborenen Schriftstellers, Komponisten und bildenden... |