- Das Haus
- Newsletter
- Service
- Publikationen
- Veranstaltungen
- NEU Livestream
- Ausstellungen
- Buchmagazin & AutorInnen
- AutorInnen
- AUFTRITTE
- Rezensionen Buch
- Rezensionen 2019
- Rezensionen 2018
- Rezensionen 2017
- Rezensionen 2016
- Rezensionen 2015
- Rezensionen 2014
- Rezensionen 2013
- Pressespiegel 2000-2010
- AutorInnen A
- AutorInnen B
- AutorInnen C
- AutorInnen D
- Autorinnen E
- AutorInnen F
- AutorInnen G
- AutorInnen H
- AutorInnen I
- AutorInnen J
- AutorInnen K
- AutorInnen L
- AutorInnen M
- AutorInnen N
- AutorInnen O
- AutorInnen P
- AutorInnen Q
- AutorInnen R
- AutorInnen S
- AutorInnen T
- AutorInnen U
- AutorInnen V
- AutorInnen W
- AutorInnen Z
- Incentives
- Rezensionen Sachbuch
- Verlage
- Dank an Verlage
- Impressum
- Bibliothek & Sammlungen
- Katalogsuche
- Partnerinstitutionen

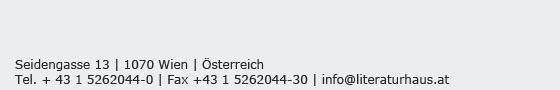
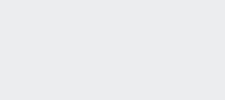


FÖRDERGEBER
PARTNER/INNEN

Leseprobe: Daniela Meisel - Der Himmel anderswo"Zuerst will ich das Meer sehen", erklärt Irina, und der Klang ihrer Stimme scheint Milo verändert, selbstsicher und bestimmt. Er willigt ein. Rasch läuft sie voraus, folgt der Beschilderung, die den Weg zum Strand weist, sodass er Mühe hat, ihr zu folgen. Seine Muskeln sind vom langen Sitzen verkrampft und seine Beine steif. Irina läuft eine Düne hinauf, zieht oben angekommen Turnschuhe und Socken von den Füßen und wirft beides von sich. Sie läuft hinunter, breitet die Arme aus, legt den Kopf in den Nacken und schreit einen Jubelruf, der Milo an das befreite Trällern eines eben aus seinem Käfig entschlüpften Vogels denken lässt. Sie wirft sich zu Boden, rollt die letzten Meter, bleibt am ebenen Strand sitzen, spuckt prustend Sandkörner und Steinchen, und er lacht wie schon lange nicht. © 2013, Picus Verlag, Wien
|
| Veranstaltungen |
|
Junge LiteraturhausWerkstatt - online
Mi, 13.01.2021, 18.00–20.00 Uhr online-Schreibwerkstatt für 14- bis 20-Jährige Du schreibst und...
Grenzenlos? (Literaturedition Niederösterreich, 2020) - online
Do, 14.01.2021, 19.00 Uhr Buchpräsentation mit Lesungen Die Veranstaltung kann über den Live... |
| Ausstellung |
|
Claudia Bitter – Die Sprache der Dinge
14.09.2020 bis 25.02.2021 Seit rund 15 Jahren ist die Autorin Claudia Bitter auch bildnerisch... |
| Tipp |
|
LITERATUR FINDET STATT
Eigentlich hätte der jährlich erscheinende Katalog "DIE LITERATUR der österreichischen Kunst-,... |
|
OUT NOW flugschrift Nr. 33 von GERHARD RĂśHM
Die neue Ausgabe der flugschrift des in Wien geborenen Schriftstellers, Komponisten und bildenden... |