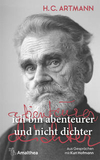- Das Haus
- Newsletter
- Service
- Publikationen
- Veranstaltungen
- Livestream
- Livestream-Archiv
- Ausstellungen
- Buchmagazin & AutorInnen
- Incentives
- Bibliothek & Sammlungen
- BĂĽcher
- Periodika
- Zeitungsausschnitte
- Bibliothekspläne
- FundstĂĽcke
- Stimmen_zur_Ukraine
- FundstĂĽcke 2019
- Artmann Jubiläum
- Aichinger Jubiläum Neuerscheinungen
- Celan Jubiläum
- Waswurdeaus
- Der Essay
- Die Kunst der Anthologie
- Literaturnobelpreis Peter Handke
- Wiederentdeckungen
- Margit Schreiners Zitatkasten
- LITERATURPassage
- Buecher in Bewegung
- Buchkultur - quo vadis?
- Zu Gast bei Alois Vogel
- 1948
- Comics, Mangas, Graphic Novels
- Cognac & Biskotten
- Ernst Waldinger
- Zitatkasten neu
- Schmidt-Dengler und die Doku
- Hochroth Verlag
- Zeitschriften um 1900
- Das literarische Quartett
- Archiv zum Anschauen
- Lesespuren
- Buchreihe
- Literatur und Politik
- Bildarchiv, Plakate
- Handschriftensammlung
- Tonarchiv
- Filmarchiv
- Schenkungen
- Katalogsuche
- Partnerinstitutionen





FÖRDERGEBER
PARTNER/INNEN

Neuerscheinungen zum 100. Geburtstag von H. C. Artmann."Meine heimat ist Österreich, mein vaterland Europa, mein wohnort Malmö, meine hautfarbe weiß, meine augen blau, mein mut verschieden, meine laune launisch, meine räusche richtig, meine ausdauer stark, meine anliegen sprunghaft, meine sehnsüchte wie die windrose, im handumdrehen zufrieden, im handumdrehen verdrossen, ein freund der fröhlichkeit, im grunde traurig, den mädchen gewogen, ein großer kinogeher, ein liebhaber des twist […], im kriege zerschossen, im frieden zerhaut, ein hasser der polizei, ein verächter der obrigkeit, ein brechmittel der linken, ein juckpulver den rechten", gibt H.C. Artmann in einer (auto-)biografischen Angabe in Das suchen nach dem gestrigen tag oder schnee auf einem heißen brotwecken, eintragungen eines bizarren liebhabers (1964) über sich Auskunft. Das unaufhörliche unterwegs sein, sowohl als Weltbürger als auch zwischen den literarischen Gattungen und den ästhetischen Kategorien zwischen Popkultur, Dialekt- und Weltliteratur, aber auch als Übersetzer zwischen den Sprachen ist wohl nicht das einzige, was von Artmann bleiben wird, denn wie er in der „Acht-Punkte-Proklamation des poetischen Actes“ (1953) konstatierte: „Der vollzogene poetische Act, in unserer Erinnerung aufgezeichnet, ist einer der wenigen Reichtümer, die wir tatsächlich unentreißbar mit uns tragen können.“ Seine sich über fünfzig Jahre erstreckende Tätigkeit im österreichischen und internationalen Literaturbetrieb bildet sich auch in den Beständen der Dokumentationsstelle ab und umfasst seine frühesten Veröffentlichungen in der Zeitschrift „Neue Wege“ (s. Abb.) und in den „Publikationen“ (s. Abb.) genauso wie die Dokumentation über den „Wiener Keller“, die Erstausgabe seines revolutionären Gedichtbandes med ana schwoazzn dintn (1958), die Übersetzungen von Horrorgeschichten des US-amerikanischen Autors H. P. Lovecraft (s. Abb.) und die nach wie vor erhältliche zweibändige, von Klaus Reichert herausgegebene „Gesammelte Prosa“ (Residenz, 2015) sowie die „Sämtlichen Gedichte“ (Jung und Jung, 5. Aufl., 2011). Ergänzend dazu bieten die Bestände der Dokumentationsstelle mehrere Dutzend Mappen mit analogen Rezeptionszeugnissen sowie über 600 Artikel mit digitalen Zeitungsausschnitten, die Werk und Person fokussieren. Zu Lebzeiten war Artmann, als einer der bekanntesten Exponenten des „Art Clubs“ und der "Wiener Gruppe", ein publikumswirksamer Popstar, wie etwa die Berichterstattung über seine Lesung im April 1967 im Palais Palffy illustriert (s. Abb.). Seine ästhetische Marginalisierung als Avantgardist und Provokateur durch den konservativ-restaurativen Literaturbetrieb in Österreich nach 1945 konnte seinen unaufhaltsamen Erfolg als „poetisches Kuriosum“ nicht aufhalten und hat Artmann auch zu einer „Leitfigur des poetischen Widerstandes“ (Alfred Kolleritsch) gemacht. Zu seinem 100. Geburtstag laden zahlreiche Publikationen dazu ein, den Dichter sowie sein umfangreiches Werk neu- bzw. wiederzuentdecken. Bei Ueberreuter erschienen ist H.C. Artmann. Bohemien und Bürgerschreck, eine ergänzte Neuauflage des 2001 erschienenen Bandes Annäherung an den Schriftsteller und Sprachspieler des Fotografen, Journalisten und Schriftstellers Michael Horowitz. Der Band, der sich wie eine schlaglichtartige Biografie liest, gibt auch Horowitz' eigene Erinnerungen an Artmann wieder, und eröffnet durch die Einarbeitung zahlreicher Quellen einen Blick auf die 1950er bis 1970er Jahre. Ein informatives persönliches Gespräch zwischen Horowitz und Rosa Artmann eröffnet den Band, der auch ein umfassendes Werkverzeichnis der selbst- und unselbständig erschienenen sowie der übersetzten Werke Artmanns bietet. Als ebenfalls ergänzte Neuauflage eines bereits 2001 erschienen Interviewbandes ist bei Amalthea ich bin abenteurer und nicht dichter, der die Gespräche des ansonsten Interviewern gegenüber eher unwilligen Artmann mit dem Journalisten Kurt Hofmann, der über Jahre in nächtelangen Gesprächen zu einem Vertrauten des Dichters wurde, dokumentiert. Neben diesen aufschlussreichen Gesprächen, die mittels Artmanns Originalaussagen dessen Biografie beleuchten und mit durchaus längeren Auszügen aus dem Werk abgerundet werden, bietet Hofmanns Band einen mediografischen Querschnitt durch Artmanns Schaffen und wird ergänzt um jene Rede, welche Klaus Reichert anlässlich von Artmanns Beerdigung hielt. Clemens J. Setz hat in einem Band mit bibliophiler Ausstattung, der in der Insel Bücherei unter dem Titel Übrig blieb ein moosgrüner Apfel erschienen ist, Naturlyrik aus dem Gesamtswerk Artmanns ausgewählt, die von Christian Thanhäuser illustriert wurde. In einem Nachwort kommentiert Setz seine Beschäftigung mit der "ekstatischen Pflanzenkunde" Artmanns. Ein Klangbuch der besonderen Art ist bei Mandelbaum unter dem Titel Um zu tauschen Vers für Kuss, gelesen von Erwin Steinhauer, mit musikalischer Begleitung von Georg Graf, Joe Pinkl und Peter Rosmanith, erschienen, in die Text-Musik-Collage verwoben ist auch Artmanns "Acht-Punkte-Proklamation des poetischen Actes" (1953). Ergänzt wird das auditive Moment um das Begleitbuch, welches Illustrationen von Linda Wolfbauer enthält sowie eine Laudatio von Klaus Reichert anlässlich der "Inthronisierung auf dem Olymp der großen Geister seines Landes" - der Verleihung des Ordens für "Wissenschaft und Kunst" aus dem Jahr 1991. Die Edition Von denen Husaren und anderen Seil-Tänzern, erschienen im Ketos-Verlag, macht einen Text Artmanns aus dem Jahr 1959 zugänglich. Der Herausgeber, der österreichisch-tschechische Autor und Philologe Ondrej Cikán, hat das Buch, in dem Artmann auf u. a. Osmanisch, Slowenisch, Provenzalisch, Spanisch, Latein, Griechisch etc. zitiert, quellenkritisch gelesen und auch kommentiert sowie die Zitate - in einem eigenen Apparat - korrigiert. Illustriert ist der Band mit Holzschnitten des Grafikers Christian Thanhäuser. Auf eine Spurensuche ins Westberlin der 1960er Jahre begibt sich der von Sonja Kaar und Marc-Oliver Schuster herausgegebene Konferenzband H.C. Artmann & Berlin, der bei Königshausen und Neumann erscheint, und das gleich in mehrerer Hinsicht: Die Beiträge umfassen u. a. Artmanns Beziehungen zu Walter Höllerer und dem Literarischen Colloquium Berlin, die Rezeption seiner Werke im Spiegel des bundesrepublikanischen Feuilletons der 1960er Jahre, aber auch sein Zusammenleben mit Elfriede Gerstl in der Berliner Kleiststraße. Im Herbst wird der Konferenzband Lovecraft, save the world! 100 Jahre H. C. Artmann, herausgegeben von Alexandra Millner, und Der Wackelatlas. Ein Gespräch mit Emily Artmann und Katharina Copony - beide Bände im Ritter Verlag - erscheinen. Während ersterer Band wissenschaftlich-essayistische sowie künstlerische Beiträge zu zentralen Themen im Werk Artmanns wie Dandyismus, Surrealismus und Populärkultur versammelt, geht der Gesprächsband auf ein kurz vor Artmanns Tod geführtes Interview für ein Filmporträt zurück und macht die Persönlichkeit Artmanns, wie kaum ein anderes Dokument, greifbar.
|
| Veranstaltungen |
|
edition exil entdeckt – Zarah Weiss blasse tage (edition exil, 2022) Ganna Gnedkova & Ana Drezga
Fr, 04.11.2022, 19.00 Uhr Neuerscheinungen Herbst 2022 mit Buchpremiere | unveröffentlichte Texte...
"Im Westen viel Neues" mit Kadisha Belfiore | Nadine Kegele | Tobias March | Amos Postner | Maya Rinderer
Mo, 07.11.2022, 19.00 Uhr Lesungen, Film & Musik Die Reihe "Im Westen viel Neues" stellt... |
| Ausstellung |
|
"Ah! THOMAS BERNHARD. Den kenn ich. – Schreibt der jetzt für Sie?"
Nicolas Mahler zeichnet Artmann, Bernhard, Jelinek, Musil & Joyce 17.09. bis 14.12.2022 Er ist der erste, der im renommierten deutschen Literaturverlag Suhrkamp... |
| Tipp |
|
OUT NOW : flugschrift Nr. 40 - Valerie Fritsch
gebt mir ein meer ohne ufer Nr. 40 der Reihe flugschrift - Literatur als Kunstform und Theorie... |
|
INCENTIVES - AUSTRIAN LITERATURE IN TRANSLATION
Buchtipps zu Kaska Bryla, Doron Rabinovici und Sabine Scholl auf Deutsch, Englisch, Französisch,... |