
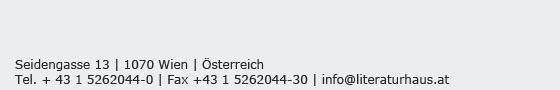
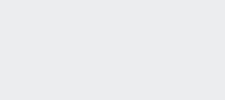


FÖRDERGEBER
PARTNER/INNEN

Semier Insayif: Im Geborgenheitsrhythmus - Semier Insayif im Gespräch mit Martin Kubaczek.Oktober 2006 Das Literaturhaus Wien zeigt von 18. Oktober bis 29. November 2006 die Ausstellung "selbst bewegt fremd" von Semier Insayif und Martin Reisinger. Der Autor Semier Insayif und der Fotograf Martin Reisinger "bespiegeln" das eigene Selbst und reagieren aufeinander mit den Mitteln ihres jeweiligen Mediums - Poesie bzw. Fotografie. Aufhorchen ließ der Lyriker Semier Insayif vor zwei Jahren im doppelten Sinn: Zu einer Einspielung der Cello-Solosuiten von Johann Sebastian Bach durch Martin Hornstein schrieb er mit dem Band libellen tänze einen mit den Bach-Suiten in Konkordanz stehenden Zyklus an Gedichten. Der im Haymon-Verlag erschienene Band wurde viel beachtet, ist er doch erstaunlich und beeindruckend in seiner Verbindung von Sensibilität und Systematik, Formenvielfalt und poetischem Spiel. Im folgenden Gespräch, am 25. September 2006 in Wien geführt, erzählte Semier Insayif, der als Kommunikations- und Verhaltenstrainer arbeitet und eine Literaturwerkstatt leitet, über Herkunft, Tennis im Leistungssportzentrum Südstadt, Medizin- und Psychologiestudium, therapeutische und mediatorische Ausbildung, Arbeit im Kriseninterventionszentrum Wien. "Dann kam die Zeit, die nach der Literatur gerufen hat." MK: Woher kam der Anreiz zu Literatur? Eine der Stimulationen waren sicher die unterschiedlichen Sprachen in meiner Familie, die arabische Sprache meines Vaters - mein Vater ist aus dem Irak, meine Mutter ist Wienerin, ich bin hier geboren. Da ist automatisch die Sprache ein Thema. Die unterschiedlichen Klänge. Die zweite Stimulation ist meine Mutter gewesen, die im Reinhardt-Seminar war und mit Schauspiel zu tun hatte und diese Lust am Reden und Sprechen leidenschaftlich übertragen hat. MK: Hast du auch Aufenthalte gehabt in Bagdad? Bist du konfrontiert worden mit der anderen Kommunikationsform? Meine Konfrontationen sind persönlicher Natur in der direkten Beziehung mit meinem Vater, der das Erzählen schon mitbringt. Da gibt es einfach eine ganz andere Art miteinander zu kommunizieren, zu sprechen, auch sprachspielerisch zu sein. Als Gesellschaftsspiel wurden da Gedichte geschrieben, rezitiert sowieso, aber auch geschrieben! MK: Gibt es da poetisch verbindliche Grundformen, auf die jeder zurückgreifen kann? Ja, wie im Japanischen, wo Dichtung traditionell auch im Zusammenkommen passiert und es Anfangs- und Endstollen gibt, gibt es da ganz klare Vorgaben, wobei es im Arabischen eine viel größere Vielfalt an Reimmöglichkeiten gibt, die man im Deutschen lautlich kaum realisieren kann. Alt tradiert, stärker vielleicht noch über die Musik transportiert. Ich habe auch von klein an mehr arabische als europäische Musik gehört. MK: Wie wird Lyrik im Arabischen vorgetragen? Poesie wird nicht gesprochen, sondern rezitiert. Man sagt im Arabischen auch Rezitator, nicht Sänger. Aber das kommt auch auf die jeweiligen Stile an. Und das hat mich vom Klang her gepackt. Das ist viel sinnlicher, unmittelbarer. MK: Bedeutet dann Literatur für dich nicht bürgerliche Einsamkeit, sondern Literatur als Begegnungsmittel, soziale Marktplatz-, Familien- und Freundschaftsfunktion? Das Erzählen hat zwar eine große Intimität gehabt, in der Nähe und Geborgenheit mit meinem Vater, aber ich erlebte immer auch, wenn ich in Bagdad war, das Sprechen und Erzählen als Bühne - viel stärker als hier. Da wird in einer Art und Weise, in einer Lautstärke und Theatralik gesprochen und erzählt, die unglaublich lustvoll ist. Ich schreibe jetzt an einer Prosa, die viel damit zu tun hat - mit diesen Sprach-Wiedererinnerungen und mit den Kulturen, explizit. MK: Wie balanciert war dein Verhältnis zu den beiden Kulturen? Ich bin nicht richtig zweisprachig aufgewachsen. Ich hab viel mitgenommen, aber die Zweisprachigkeit war nie richtig durchgezogen. Mein Vater hat nicht konsequent arabisch mit mir gesprochen, Deutsch war doch die Familiensprache. Ich habe in letzter Zeit begonnen, mir vieles wieder zu holen über die Sprache - sie zu lernen, und das ist gerade eine spannende Phase, weil dadurch in mir frühe Körpererinnerungen wieder auftauchen. Ich habe mich an der Uni eingeschrieben am Sprachinstitut und beginne wieder Hocharabisch zu lernen. Das ist für mich insofern interessant, als darüber sehr, sehr viel Vokabular zurückkehrt, wieder auftaucht. Und wenn es auftaucht, in meiner Artikulation, taucht es in einem arabischen Dialekt auf. Das ist für mich in meiner Identität spannend, weil ich mich noch nie verortet hätte im Arabischen, weil ich die Sprache nicht wirklich intus habe, und dann ist es interessant von der Sprachlehrerin zu hören, dass ich einen städtischen Dialekt aus Bagdad spreche, und ich freue mich und bin gleichzeitig befremdet, dass ich da dialektal verortet werde. Dann tauchen ganz körperliche Erinnerungen auf, die ich so schon lange nicht mehr bewusst hatte. Also wenn mein Vater mir Geschichten erzählt hat, als kleiner Stöpsel zu Hause, und er mich geschnappt hat, wenn er Ordination gehabt hat in einer Pause zu Mittag, und mir so kleine Fabeln erzählt hat, vom Fuchs und vom Bären, auf Arabisch. Das wird dann spürbar - die Stimme, die sehr nahe war, der Körperkontakt. MK: Das heißt, Erzählen geht mit Geborgenheit einher? Richtig, fast wie ein Rhythmus, ein Geborgenheitsrhythmus, könnte man fast sagen. MK: Schaust du dann quasi Wange an Wange hinüber in die jeweils andere Kultur? Ich lebe hier gern und habe sehr positive Erfahrungen gemacht, die mir aufgrund des Sozialstatus meines Vaters - er ist Arzt - möglich geworden sind. Gleichzeitig merke ich, irgendwie gehöre ich nicht daher. Das war immer spürbar für mich - in der Sprache, in der Identität, im Wohlfühlen - ich merke das immer, wenn ich wo anders bin: Ich sage nicht "Ich bin Österreicher", ich sage "Ich lebe in Österreich". Das sind Dinge, die so tief drinnen sind, die ich durchaus spannend finde und möglicherweise hat das damit zu tun, dass so ein "an der Grenze sein" mir auch das Gefühl gibt, sowohl das eine als auch das andere zu erleben. Da gibt es etwas, das ich produktiv finde jeweils für das eine und das andere. Und auch in den literarischen Arbeiten hab ich immer die Grenzräume gesucht: Wo trifft die Sprache auf die Musik? Wo gibt es die Ähnlichkeit, die Unterschiedlichkeit. Und ich lerne dabei für die Literatur und Poesie sehr viel, wenn ich mir ein anderes Medium über die größere Distanz bewusster mache, oder mir bewusster mache, wo welche Grenzen liegen. MK: Sind das dann lyrische Übertragungsversuche, so in dem Sinn: wie kann ich den emotionalen Wert in meinem System adäquat reinstallieren, so dass ich eine ähnliche Befindlichkeit vermittle wie in der anderen Kunst? In den Bewegungsgedichten nicht, da war die Vorlage nicht da. Aber in der Bach-Arbeit war es so, wobei ich aber immer auch etwas hinzufügen wollte; ich weiß nicht, ob "hinzufügen" das richtige Wort ist - im Grunde genommen sind die Störverse, die so dazwischen gelegt sind, eigentlich ein Dagegenlaufen gegen diese Bachsche Perfektion. Die ist fast nicht auszuhalten in dieser Meisterschaft, so dass sich ständig eine Stimme bei mir gewehrt hat: Sie stören zu wollen, brechen zu wollen, dagegen anzukämpfen auch. MK: Wie ist es zur zentralen Chiffre der Libelle gekommen? Meine Erst-Assoziation kommt aus dem Hören. Gleich aus dem Beginn der ersten Suite, da bin ich gelegen und hab mir gedacht: Also, das ist ein Flug. Und dann der Bogenflug, wenn ich Streicher sehe, wie sie über die Saiten gehen! Es gibt schon zwei Momente bei Bach, gerade in den Suiten sehe ich das, nämlich Motorisches und Architektonisches; dieses Treibende, Maschine irgendwie, aber auch diese Leichtigkeit im Raum. Da hab ich begonnen, mich mit der Libelle zu beschäftigen. Mich nur eingearbeitet, mich beschäftigt mit der Materie. Dann habe ich die unterschiedlichsten Interpretationen gehört, von Casals bis heute, von Yo-Yo Ma bis zu Bylsma. Und auf der anderen Seite habe ich Opitz gelesen, das "Buch von der deutschen Poeterey", die erste deutsche Poetik. Damit kam ich zu Konstrukten. Ich habe eine Struktur gesucht. Ich wollte die Verbindung horizontal und vertikal machen. Ich habe ein Gedicht geschrieben - ein Urgedicht sozusagen - mit der Auflage, eine Zeile ist eine Suite. Dann kommen die Suite-Gedichte, wobei jeweils die erste Zeile von dem Muttergedicht stammt, und dann pflanzen sich die Gedichte auch wieder in den Tanzgedichten fort. Dann habe ich überlegt, jedes Präludium soll auch horizontal vergleichbar sein, die Präludien sind nicht gereimt, sie sind sozusagen freier, weil sie ja von der Improvisation her kommen. Dann habe ich versucht, auch der Allemande als deutschem Tanz eine lyrische Form zu verleihen, der habe ich den Schweifreim zugeordnet, der deutsche Tradition hat, aus dem 16., 17. Jahrhundert und früher. Die Courante hat mehr so dieses Laufende, die Terzine wiederum das Strophenübergreifende. Ich habe versucht auch Reimformen für die Tänze zu finden, die auf eine gewisse Weise auch formal etwas in sich tragen, wo ich sage, das ist erlebbar - das Ritournell in der Sarabande, wo die erste Verszeile fast nur ein Wort oder ganz verkürzt ist, wo der Raum so aufgemacht wird, in dieser Langsamkeit. Also solche Bezüge habe ich versucht zu finden und sie dann durchzuziehen, auch motivisch. Da gibt es sechs Libellenarten, die herumschwirren im poetischen Raum, wie etwa "Blaupfeil" oder "Smaragd"; das sind einerseits Dinge, die man in der Natur wiederfindet, zugleich ist es aber ein Anklang an eine Libelle. Ich habe das so versucht, dass die Libelle im Gesamtkonzept manchmal verschwindet, aber dann auch wieder klar auftaucht. Also nicht so sehr die Linearität betont, als das Wiederkehren von Motiven. MK: Ich war überrascht über so viel Naturidyllik. Ist das nicht eher Romantik als Barock? Nicht unbedingt. Die Libelle hat einen Stachel und ist auch nicht ganz harmlos. Die Libelle ist nur scheinbar so eine schönes, schillerndes Wesen, das ist eine Fressmaschine, eines der größten Raubtiere, die es gibt, mit seiner Fangmaske, auch im Imago-Stadium ist es eine Fressorgie, die sie veranstaltet. MK: Deine poetische Vorgehensweise hat für mich manchmal etwas Kaleidoskopisches, du schüttelst die Versatzstücke in eine neue Zusammenstellung, um eine neue Leuchtkraft und neue Buntheit zu sehen. Das ist sehr ornamental und insofern doch auch arabisch? Ja, arabesk! Das ist aber auch das Barock, wiederum! Wenn ich arabische Musik mit irgendeiner Musiktradition hier vergleiche, dann ist es das Barock, weil ich auch bei Bach zum Beispiel diese Scheinpolyphonie finde - etwa in den virtuosen Spieltechniken in den Gamben- und Cellosuiten, wo Bach einzelne Töne aus den arpeggierten Akkorde durch die Setzweise hervorhebt, so dass parallele Melodielinien entstehen, eine Technik, die als style brisé bezeichnet wurde, also durch Brechung der Akkorde entsteht. Seine Musik ist da ursprünglich nicht polyphon angelegt, und das ist auch im Arabischen ganz stark so. Da ist fast alles solistisch einstimmig gesungen, auch in dieser Tradition, die mit Scheinpolyphonien arbeitet, und in dieser unglaublich arabeskenhaften Weise, heranzugehen, da gibt es eine große Verbindung. MK: Es überrascht da eine starkes intellektuelles Gerüst, sehr viel Vorarbeit, auch sehr viel Absicherung. Quasi mehr Ingenieur als Bricoleur, nach der Gegenüberstellung von Levi-Strauss? Das interessiert mich grundsätzlich, aber bei den Bachgedichten habe ich das Gefühl gehabt, dass es noch notwendiger ist, weil dieses Assoziative, das ich selbst erlebt habe beim Hören, so stark ist und fast gefährlich. Bach gibt das auch so vor, diese Verbindung von Rationalem und Emotionalem und die Kunst, beides in Schwebe zu halten, ohne Präferenz. MK: Auch schon in deinem ersten Gedichtband "über gänge verkörpert" hast du dich intensiv mit dem auseinandergesetzt, was die abendländische Kulturgeschichte zum Thema "Bewegung" ausgearbeitet hat - Irgendwie hat sich das destilliert, dass ich das Phänomen der Bewegung in Gedichte bringen wollte. Ich habe begonnen, mir Wortfelder anzulegen, die mit Bewegung operieren, Worte wie vorwärts, rückwärts, seitwärts, so in der Art, und mich gefragt, was ist Bewegung in unterschiedlichen Disziplinen, in der Philosophie, in der Musik, in der Mathematik, Bewegung im Sinn des Körperlichen, Leiblichen. Das Wort Bewegung ist etymologisch schon so interessant, da ist transitiv/ intransitiv innerhalb des Wortes selbst angelegt. Es gibt von Friedrich Kaulbach ein Buch aus den Sechzigerjahren, in dem er den Begriff der Bewegung in der Philosophie bei Aristoteles, Leibniz und Kant nachvollzieht, und diese Aristotelische Herangehensweise der Dynamis, Energeia, Entelecheia war für mich dann eine Grundlage auch einzusteigen. MK: Wie definiert sich der Begriff der Bewegung dann lyrisch für dich? Bewegung wird immer nur in ihren Übergängen erkennbar von einem Etwas in ein Etwas, im Umschlagen von einem Zustand in einen (anderen) Zustand. Und dieses ständige Umschlagen wollte ich mit Mitteln der Poesie und für die Poesie umsetzen, so dass eine Denkbewegung sich in eine Schreibbewegung umsetzt, in eine leibliche Bewegung. Das war ein sehr grundlegendes Tun, sehr abstrahiert, aber dann doch wieder auch sehr materiell. Aber ein Vorgabemedium wie die Musik gab es da nicht. Aber meine Idee war immer, eigentlich möchte ich Gedichte "vertanzt" sehen, wie geht das; Und da bin ich in einen Dialog gekommen mit zwei Tänzerinnen, wir haben einfach gefragt, wie könnte man Gedichte vertanzen, was fällt euch ein dazu. Das hat was mit Bewegungssprache zu tun, welches Vokabular gibt es da, welche Ausdrucksform. MK: Du arbeitest mit dem sprödesten der Medien, das am weitesten weg ist im Abstrahieren von den Phänomenen, nämlich der Sprache, und gehst dabei immer auf Ursprungsmedien zurück: Tanz, Musik, Geste, Bewegung? Das ist dieser Bogen - einerseits etwas Abstrahiertes, andererseits trotzdem diesen Bogen zum Ursprung zu versuchen. Und ich möchte sehen, was ist übertragbar und was nicht, von einem Medium ins andere, wo ist die Differenz, wo die Gemeinsamkeit, aber auch, wo ist die genuine Leistung. Und was ist darüber hinaus in der Sprache möglich, was in anderen Medien nicht möglich ist, und umgekehrt. MK: Wie weit spielt das Rationale im Körperlichen eine Rolle für dich? Das findet sich etwa in der Frage: inwiefern ist die Schreibbewegung mit der Denkbewegung gekoppelt? Das Interessante für mich ist, dass der Motivation, die Hand zu bewegen, eine Bewegung zu vollführen, die sich in Schrift ausdrückt, eine Denkbewegung vorausgeht, und es eine unsichtbare Bewegung gibt, sozusagen, die ständig den Körper motiviert. Darum habe ich auch das Motiv des Puppenspielers hinein genommen, weil an diesem so interessant ist, wer bewegt eigentlich wen. Die Fäden sind da, aber holt die Puppe nicht eigentlich viel stärker denjenigen zu sich, der bewegt? Das habe ich am Ende hingesetzt, ich habe damit einen Vorhall und einen Nachhall, so als Zange, und das Puppenspielmotiv geht darüber hinaus. Ich wollte auch kein Ende, es gibt zwar eine Figur, man geht durch einen Gedichttext durch, aber zum Schluss gibt es die Puppenspielerfrage. Ich wollte immer auch etwas, das nicht zu Ende ist, das das Gesagte wieder aufhebt, in Schwebe bringt, weil ich das Gefühl habe, eigentlich, nachdem ich das gemacht habe, müsste ich noch einmal anfangen, jetzt müsste ich erst beginnen, was paradox ist: Nachdem ich dieses Ursprungsgedicht im Bach-Zyklus geschrieben habe, das eine Gedicht, und mich langsam verzweigt habe in die Tänze, habe ich das Gefühl bekommen, jetzt müsste ich nochmals anfangen, das eine Ursprungsgedicht neu schreiben, ich bin erst durchgelaufen durch Mikrobereiche, so dass ich jetzt erst beginnen kann. Und so hab ich dann das Ursprungsgedicht zwei Mal geschrieben - das gibt es zwei Mal, einmal auf der Karte, die dem Buch beigelegt ist, man kann es mitnehmen und schauen und vergleichen, was steckt davon in den einzelnen Tänzen noch drinnen, und am Ende ist das Stammgedicht noch einmal drinnen. Es hat sich jetzt verändert, und eigentlich sollte ich jetzt noch einmal beginnen. Das soll auch symbolisieren, dass es nicht zu Ende ist, bei weiten nicht zu Ende ist, es kann nie diesen Perfektionsanspruch haben, es ist eine Annäherung gewesen, jetzt müsste man es weiter schreiben. Es ist mir wichtig, es auch nicht ganz "rund" zu machen. Es ist keine Kreisbewegung. Wenn schon, dann eher eine Spirale, was Offenes. Es hat mit einem poetischen Erkenntnisprozess zu tun; und das war schon in den Bewegungsgedichten drinnen. Was mich so verblüfft hat war, dass Bewegung dann in den Bach-Libellen noch einmal so stark vorkommt, natürlich nicht in einer expliziten Form, aber völlig implizit drinnen ist. Dass Bewegung als Phänomen schon ein ganz zentraler Bereich ist, der für mich bedeutend ist. MK: Wie funktioniert das in der Auseinandersetzung mit dem Visuellen, derzeit in deiner Kollaboration mit dem Fotografen Martin Reisinger? Ausgehend von Selbstportraits im 20. Jahrhundert bin ich mit Martin Reisinger zusammengekommen, der auch motivisch sehr eng begrenzt arbeitet, streng schwarz/weiß, mit Verwischungen, indem er sich vor der Kamera bewegt. Wir arbeiten dialogisch: ich schicke ihm Texte, er arbeitet dazu, schickt mir Fotos, ich schreibe was dazu, da gibt es eine dialogische Aktion/Reaktion, einen Entwicklungsprozess in der Artikulation. Auch hier arbeite ich wieder mit Wortfeldern, die ich thematisch erstelle, Ansicht, Gesicht, Summe des Sehens. Er schickt Fotos, in denen Bewegung drinnen ist, nichts Statisches, aber wo das Element der Kluppen wiederkehrt - dieser schlichten Holzkluppen, die man von der Wäscheleine, aber auch von der Dunkelkammer her kennt. Und ich mache dann dazu Gedichte etwa mit Buchstaben-Stempeln auf Transparentpapier, Buchstabe für Buchstabe, die er wiederum an den Kluppen aufhängt, vor denen er sich bewegt. Viele Bezüglichkeiten, aber auch Entfremdendes taucht auf, Dinge, auf die man nicht mehr in seinem Medium weiter reagieren kann, die bleiben dann so stehen. Einige der solcherart entstandenen - scheinbaren - Endpunkte in diesem Prozess werden wir auch in der Ausstellung im Literaturhaus zeigen. |
| Veranstaltungen |
|
Sehr geehrte Veranstaltungsbesucher
/innen! Wir wünschen Ihnen einen schönen und erholsamen Sommer und freuen uns, wenn wir Sie im September... |
| Ausstellung |
| Tipp |
|
OUT NOW: flugschrift Nr. 35 von Bettina Landl
Die aktuelle flugschrift Nr. 35 konstruiert : beschreibt : reflektiert : entdeckt den Raum [der... |
|
INCENTIVES - AUSTRIAN LITERATURE IN TRANSLATION
Neue Buchtipps zu Ljuba Arnautovic, Eva Schörkhuber und Daniel Wisser auf Deutsch, Englisch,... |