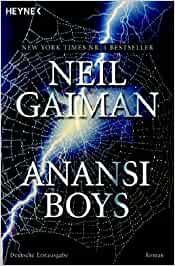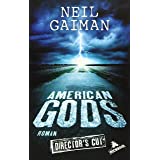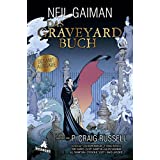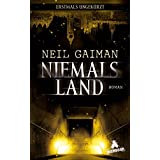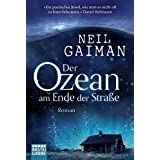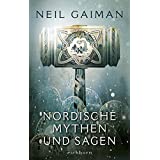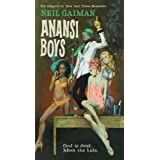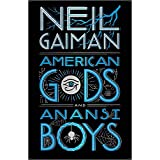Neil Gaiman ist Fantasylesern und Comic-Fans gleichermaßen ein Begriff -- mit seinen
Sandman-Comics hat der Brite und Wahlamerikaner in der Comic-Kunst neue Maßstäbe gesetzt. In jüngster Zeit hat er auch mit zahlreichen Romanen von sich reden gemacht, unter anderem mit dem preisgekrönten
American Gods. Im selben Universum ist auch sein neuer Roman
Anansi Boys angesiedelt und zeigt Gaiman in neuer Inkarnation als trickreichen Erzählergott Anansi, der eine ebenso wahnwitzige wie tiefsinnige Geschichte spinnt.
Die Hauptfigur des Romans, Fat Charlie Nancy, ist ein in Florida aufgewachsener Schwarzer, der seine Heimat verlässt, um zu seiner Verlobten Rosie nach London zu ziehen. Charlie führt ein in jeder Hinsicht gewöhnliches Leben, er arbeitet als Buchhalter in einer Künstleragentur. Dies ändert sich jedoch schlagartig, als sein Vater stirbt, und Charlie nach Florida fliegt, um sich um seine Beerdigung zu kümmern.
In seiner Heimatstadt warten einige Überraschungen auf ihn -- wie sich herausstellt, war sein Vater die irdische Verkörperung des westafrikanischen Spinnengottes Anansi und hat außer Charlie noch einen weiteren Sohn hinterlassen. Charlie nimmt mit seinem unbekannten Bruder Spider Kontakt auf, der das ganze Gegenteil von ihm ist: gut aussehend, charmant, selbstbewusst und zu allem Überfluss auch noch mit magischen Fähigkeiten begabt. Spätestens als Spider Charlies Verlobte Rosie zu umgarnen beginnt, bereut dieser, seinen Bruder in sein Leben geholt zu haben und setzt nunmehr alles daran, ihn wieder loszuwerden.
Gaiman erzählt die archetypische Geschichte zweier ungleicher Brüder und das mit soviel Witz und Fabulierfreude, dass der Leser nur noch den Atem anhalten kann. Nicht von ungefähr verweist Gaiman auf P. G. Wodehouse, Throne Smith und Tex Avery als Künstler, die ihn bei diesem Werk beeinflusst haben. In typischer Gaimanscher Manier wird die Handlung des Romans außerdem von einem ganzen Labyrinth mythologischer Bezüge überlagert, die ihm zusätzliche Tiefe verleihen. Anansi Boys ist Gaimans bislang zugänglichster Roman -- ein Buch wie ein Cartoon, rasant, komisch und brillant erzählt! -- Steffi Pritzens
"Gaiman ist ein glänzender Geschichtenerzähler...eine Art moderner Märchenonkel aus Tausendundeiner Nacht." (Der Spiegel )
"Gaiman ist ein wandelnder Blog voll von jederzeit abrufbaren Anekdoten." (Der Spiegel )
"Neil Gaiman ist schon lange ein Popstar." (Vanity Fair )
Klappentext
"Gaimans Romane sind wahre Schätze."
Stephen King
"In den USA ist Neil Gaiman ein Superstar."
buchreport express
"Ein Autor von unglaublicher Vorstellungskraft."
William Gibson
Über den Autor und weitere Mitwirkende
Der Engländer Neil Gaiman, 1960 geboren, arbeitete zunächst in London als Journalist und wurde durch seine Comic-Serie Der Sandmann bekannt. Neben den Romanen Niemalsland und Der Sternwanderer schrieb er zusammen mit Terry Pratchett Ein gutes Omen und verfasste über seinen Kollegen und Freund Douglas Adams die Biographie Keine Panik!. Er lebt seit einigen Jahren in den USA.
Leseprobe. Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Rechteinhaber. Alle Rechte vorbehalten.
KAPITEL EINS
IN DEM ES HAUPTSÄCHLICH UM NAMEN UND FAMILIENVERHÄLTNISSE GEHT
ES BEGINNT, WIE ES JA MEISTENS DER FALL IST, MIT EINEM LIED. Im Anfang waren schließlich die Worte, und dazu gab es auch gleich eine Melodie. So wurde die Welt geschaffen, so wurde das Nichts geteilt, so kamen sie alle in die Welt: die Landschaften und die Sterne und die Träume und die kleinen Götter und die Tiere.
Sie wurden gesungen.
Die großen Tiere wurden ins Dasein gesungen, nachdem der Sänger mit den Planeten und den Hügeln, den Bäumen, den Meeren und den kleineren Tieren fertig war. Die das Dasein begrenzenden Klippen wurden ersungen, die Jagdgründe und die Dunkelheit.
Lieder sind dauerhaft. Sie währen ewig. Das richtige Lied kann einen großen Herrscher zum Gespött machen, kann ganze Dynastien stürzen. Ein Lied kann noch bestehen, nachdem die Ereignisse und Menschen, von denen es handelt, längst zu Staub zerfallen, nur noch ferne Träume sind. Das ist die Macht der Lieder.
Es gibt noch mehr, was man mit Liedern anfangen kann. Sie bauen nicht nur Welten oder erschaffen neues Leben. Fat Charlie Nancys Vater zum Beispiel benutzte sie einfach nur, um gepflegt einen draufzumachen und einen, wie er hoffte, beziehungsweise mit einiger Sicherheit erwartete, angenehmen und geselligen Abend zu verleben.
Bevor Fat Charlies Vater die Bar betreten hatte, war in dem Barkeeper die Überzeugung gereift, dass der ganze Karaoke-Abend sich zu einer deftigen Pleite entwickeln würde. Aber dann war der kleine alte Mann in den Raum stolziert und an dem Ecktisch gleich neben der improvisierten Bühne vorbeigekommen, an dem mehrere blonde Frauen mit frischen Sonnenbränden und dem typischen Touristinnenlächeln saßen. Er sah sie an und tippte sich an den Hut, denn, fürwahr, er trug einen Hut, einen makellosen grünen Filzhut, und dazu zitronengelbe Handschuhe, und dann trat er an ihren Tisch. Sie kicherten.
»Amüsieren Sie sich auch gut, meine Damen?«, fragte er.
Sie fuhren fort zu kichern und teilten ihm mit, ja, sie hätten viel Spaß, danke sehr, und sie seien hier im Urlaub. Er versicherte ihnen, es würde noch viel besser werden, sie sollten nur abwarten.
Er war älter als sie, viel, viel älter, aber er war charmant, der Charme in Person, wie ein Überbleibsel aus längst vergangenen Zeiten, als Höflichkeit und gute Manieren noch etwas gegolten hatten. Der Barkeeper entspannte sich. Wenn man so jemand in der Bar hatte, dann würde es ein guter Abend werden.
Es gab Karaoke. Es gab Tanz. Der alte Mann stieg auf die improvisierte Bühne, um zu singen, nicht nur einmal, sondern zweimal an diesem Abend. Er hatte eine schöne Stimme und ein prachtvolles Lächeln, und seine Füße funkelten, wenn er tanzte. Das erste Mal, als er hinters Mikrofon trat, sang er »What’s New Pussycat?«. Als er sich anschickte, zum zweiten Mal zu singen, ruinierte er Fat Charlies Leben.
DICK WAR
FAT CHARLIE EIGENTLICH NUR EINIGE WENIGE JAHRE lang, von kurz bevor er zehn wurde – was die Zeit war, als seine Mutter der Welt verkündete, dass, wenn es eins gebe, mit dem sie endgültig fertig sei (und falls der betreffende Herr dagegen irgendwelche Einwände habe, könne er sich diese sonst wohin stecken), dann sei es ihre Ehe mit diesem alternden Bock, den sie fatalerweise einst geheiratet habe und den sie am nächsten Morgen verlassen werde, um irgendwohin weit weg zu gehen, und er solle ja nicht versuchen, ihr zu folgen – bis zum Alter von vierzehn, als Fat Charlie ein wenig in die Höhe schoss und mehr Sport trieb. Er war nicht fett. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, war er nicht mal pummelig, sondern einfach nur an den Rändern ein bisschen weich geformt. Aber der Name Fat Charlie blieb an ihm kleben, wie ein Kaugummi an der Sohle eines Tennisschuhs. Vorstellen tat er sich als Charles oder, mit Anfang zwanzig, als Chaz oder schriftlich als C. Nancy, doch es hatte alles keinen Zweck: der Name schlich sich ein, infiltrierte jeden neuen Abschnitt seines Lebens wie Kakerlaken, die sich, auch wenn die Küche noch so neu ist, in den Rissen und der Welt hinter dem Kühlschrank ausbreiten, und ob es ihm gefiel oder nicht – Letzteres war der Fall –, schon hieß er wieder Fat Charlie.
Es lag daran, das wusste er wider alle Vernunft, dass es sein Vater gewesen war, der ihm den Spitznamen gegeben hatte, und wenn sein Vater Dingen Namen verlieh, dann blieben diese haften.
Da war zum Beispiel der Hund von der anderen Straßenseite, in Florida, wo Fat Charlie aufgewachsen war. Ein kastanienbrauner Boxer, mit langen Beinen, spitzen Ohren und einem Gesicht, das aussah, als sei das Tier als Welpe mit dem Kopf voran gegen eine Mauer gerannt. Der Kopf war hoch aufgerichtet, ebenso der Stummelschwanz. Es handelte sich unverkennbar um einen Aristokraten unter den Vierbeinern. Er hatte an Hundeschauen teilgenommen. Er hatte Preise gewonnen, eine Rosette für die beste Zucht, eine Rosette für den Besten seiner Kategorie und sogar einen Hauptpreis für den »Best in Show«. Dieser Hund erfreute sich des Namens Campbell’s Macinrory Arbuthnot der Siebte, und wenn seine Besitzer in jovialer Stimmung waren, nannten sie ihn Kai. Dies dauerte so lange, bis eines Tages Fat Charlies Vater, während er vor der Haustür auf der klapprigen Hollywoodschaukel saß und sein Bier schlürfte, den Hund bemerkte, der im Garten der Nachbarn hin und her stolzierte, an einer Leine, die von einer Palme bis zu einem Zaunpfosten reichte.
»Was für ein trotteliger Hund«, sagte Fat Charlies Vater. »Wie dieser eine Freund von Donald Duck. Hey, Goofy.«
Und was eben noch ein mit Ehren überhäuftes Prachtexemplar gewesen war, sank plötzlich in sich zusammen. Fat Charlie kam es so vor, als würde er den Hund jetzt mit den Augen seines Vaters sehen, und, ja doch, verdammt, es war wirklich ein ziemlich doofer Hund, wenn man es genau bedachte. Ein Volltrottel praktisch.
Es dauerte nicht lange, da hatte sich der Name in der ganzen Nachbarschaft verbreitet. Campbell’s Macinrory Arbuthnot des Siebten Besitzer kämpften dagegen an, aber da hätten sie sich genauso gut auf eine Auseinandersetzung mit einem Wirbelsturm einlassen können. Völlig Fremde kamen vorbei, tätschelten dem einstmals stolzen Boxer den Kopf und sagten: »Hallo, Goofy, alter Knabe, wie geht’s?« Die Besitzer verzichteten anschließend darauf, ihn zu weiteren Hundeschauen anzumelden. Sie brachten es nicht übers Herz. »Sieht ein bisschen trottelig aus, der Hund«, sagten die Juroren.
Die Namen, die Fat Charlies Vater verteilte, hafteten. So war das eben.
Das war aber, was Fat Charlies Vater betraf, bei Weitem noch nicht das Schlimmste.
Es hatte im Verlauf seiner Kindheit so manchen Kandidaten für den Titel »Schlimmste Eigenschaft seines Vaters« gegeben: die lüstern umherschweifenden Augen und die ebenso abenteuerlustigen Finger, dies jedenfalls nach Auskunft der jungen Damen aus der Umgebung, die sich häufig bei Fat Charlies Mutter beklagten, worauf es jedes Mal Ärger gab; die kleinen schwarzen, von ihm als Stumpen bezeichneten Zigarillos, die er rauchte und deren Geruch sich an alles heftete, womit er in Berührung kam; seine Vorliebe für eine seltsam schlurfende Form des Stepptanzes, die, so Fat Charlies Vermutung, allenfalls mal eine halbe Stunde lang im Harlem der 20er Jahre angesagt gewesen war; seine vollkommene und unerschütterliche Unkenntnis der aktuellen Weltlage, verbunden mit der tief verwurzelten Überzeugung, dass Sitcoms im Fernsehen einem einen halbstündigen Einblick in das Leben und die Probleme echter Menschen verschafften. Keins dieser Dinge war für sich genommen das Schlimmste an seinem Vater, soweit es Fat Charlie betraf, wenn sie auch alle miteinander zu diesem Schlimmsten durchaus beitrugen.
Das Schlimmste an Fat Charlies Vater war schlicht und einfach dies: Er war peinlich.
Nun sind natürlich alle Eltern peinlich. Das liegt in der Natur der Sache. Eltern sind peinlich einfach dadurch, dass sie...