In der öffentlichen Rezeption wurde und
wird Bertolt Brecht in erster Linie als gesellschaftskritischer
marxistischer Bühnenautor wahrgenommen, der das epische
Theater des 20. Jahrhunderts revolutionierte und dessen
Lehrstücke heute noch zu den weltweit am häufigsten
gespielten zählen. Der für ihn notwendige Gebrauchswert
seiner Texte zielte auf politische Veränderung, und so folgen
auch viele seiner Gedichte, vor allem die von Kurt Weill und Hanns
Eisler vertonten, der unmittelbaren Wirkungsabsicht leicht
verständlicher Sinn- und Bildhaftigkeit.
Nachdem der Suhrkamp Verlag 1976 Brechts "Gesammelte Gedichte
in vier Bänden" herausgegeben hatte, erschien dort 2006
diese von Werner Hecht neu zusammengestellte Auswahl der
"Liebesgedichte" mit einigen bisher
unveröffentlichten Texten, die mit Rücksicht auf
bestimmte Geliebte vorher zurückgehaltenen worden waren.
Ein "gesitteter" Autor ist Brecht zeitlebens nicht
gewesen - und so ist es wenig überraschend, dass er sich in
seiner Lyrik ebenfalls nicht um moralische Etikette und
"political correctness" scherte. Stattdessen wählte
er die Mittel einer unverstellt volksnahen, oft sexuellen Sprache,
die den Leser derb und frivol direkt aus der Szene anspringt und so
das jeweilige "lyrische Ich" als agierendes und leidendes
Subjekt lebendig macht.
|
|
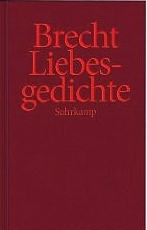 |
Durch die chronologische Anordnung der Gedichte (1917-1956)
lässt sich auch Brechts Wandel vom frühen Anarchisten zum
klassenkämpferischen marxistischen Provokateur und letztlich
welt- und liebesbejahenden Utopisten nachempfinden. Die hier
ausgewählten Texte erheben zwar genregemäß nicht den
agitatorisch-politischen Anspruch wie der Großteil seiner
anderen, oft dialektisch belehrenden Arbeiten, doch spiegelt sich
auch in den frühen Gedichten der Nihilismus des jungen Brecht,
das "Baalsche Weltgefühl", in der ungeschönten,
oft krassen Darstellung des asozialen Materialismus einer
Gesellschaft, in der die Liebe keinen Bestand haben kann, zur rein
animalischen Triebabfuhr wird und kurz auflebende Gefühle im
schnellen Vergessen versinken. Diese Wandelbarkeit aller
menschlichen Gefühle symbolisiert Brecht oft in Naturbildern,
etwa der "Wolke", die durch etliche Gedichte schwebt. Wie
in dem schon in der Gedichtsammlung "Hauspostille" (1927)
veröffentlichten Text "Erinnerung an die Marie A.",
in dem die Naturkulisse als Bild die Erinnerung an "jene
Frau" überlebt: "Doch ihr Gesicht, das weiß ich
wirklich nimmer /[...] / Und auch den Kuß, ich hätt ihn
längst vergessen / Wenn nicht die Wolke da gewesen
wär".
In dem thematischen Umfeld der Vergänglichkeit von Erotik und
sexueller Attraktivität bewegen sich auch die anderen
frühen Gedichte, etwa das Sonett "Entdeckung an einer
jungen Frau", in der eine graue Strähne den
körperlichen Verfall ankündigt und es deshalb keine Zeit
zu vergeuden gilt: "Doch nütze deine Zeit, das ist das
Schlimme / Daß du so zwischen Tür und Angel stehst / Und
laß uns die Gespräche rascher treiben / Denn wir
vergaßen ganz, daß du vergehst".
Zwar bleiben bei Brecht auch nach seiner dezidierten Hinwendung zum
Kommunismus Mitte der 1920er-Jahre die pessimistische Grundhaltung
und die Vergänglichkeitsthematik die Leitmotive seiner
Gedichte, werden aber nun nicht mehr allein durch die menschliche
Unzulänglichkeit begründet, sondern zunehmend durch die
sozialen und wirtschaftlichen Lebensbedingungen einer Gesellschaft,
in der auch die Realisierbarkeit von Liebe an ökonomische
Umstände gebunden ist. Für das Verkommen der Liebe in der
kapitalistischen Warenwelt stehen die Dirnen, denen Brecht
häufig sehnsüchtig-klagende, aber auch desillusionierte
und zynische Stimmen verleiht. Die "Nanna" etwa
"Lernte auf der Liebesmeß / Lust in Kleingeld zu
verwandeln" und erkennt am Ende "Gottseidank geht alles
schnell vorüber / Auch die Liebe und der Kummer sogar / Wo
sind die Tränen von gestern abend? / Wo ist der Schnee vom
vergangenen Jahr?"
Diese Resignation entlarvt jede romantische Idealisierung und
Heuchelei, wenn es wie im "Kuppellied" heißt:
"Ach, was soll des roten Mondes Anblick / Auf dem Wasser, wenn
der Zaster fehlt? /[...] / Gute Mädchen lieben nie / Einen
Herrn, der nichts verzehrt / Und der Grund ist: Geld macht sinnlich
/ wie uns die Erfahrung lehrt." Die zum Überleben
notwendige kapitalistische Hurenphilosophie gipfelt im Refrain des
"Lied der Jenny" (aus der "Mahagonny-Oper"),
wenn sie die berühmten Zeilen singt: "Denn wie man sich
bettet, so liegt man / Es deckt einen keiner da zu / Und wenn einer
tritt, dann bin ich es / Und wird einer getreten, dann bist's
du."
Hat also die Liebe als positives Lebensgefühl bei Brecht gar
keine Chance? Wenn man die Liebe als Vermittlerin und
Grenzgängerin zwischen den individuellen Sehnsüchten,
sozialen Realitäten und der Idee von einer humaneren
Gesellschaft wirken lässt, kann sie zur Basis eines
persönlichen, gesteigerten Glücksgefühls werden,
denn: "Wenn ich liebe, wenn ich fühle / Werd ich wieder
heiß." Die Liebe als Ausdruck freundlicher
zwischenmenschlicher Beziehungen in einer künftigen Zeit, da
"der Mensch dem Menschen ein Helfer" sein solle, in der
Utopie einer Gesellschaft mit sozialer und wirtschaftlicher
Gerechtigkeit als Voraussetzung, um "die Liebe in
völligen Einklang mit anderen Produktionen zu
bringen".
Wie immer man auch zu Brechts Intentionen als politischer
Wirkungsdichter stehen mag, diese Gedichtauswahl mit teils neuen,
teils wohlbekannten Versen überrascht durch ungestüme,
subjektive Radikalität und zeigt einen Dichter, der auch in
intimen Liebesangelegenheiten alle Hüllen fallen lässt
und ohne verschwurbelte Sentimentalität sämtliche
Facetten zwischen Lust und Verzweiflung, Resignation und Hoffnung
als emotionalen Treibstoff für die Inspiration zur aktiven
gesellschaftlichen Teilhabe in freche Verse gießt.
Bertolt Brecht: Liebesgedichte.
Ausgewählt von Werner Hecht.
Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M. 2006.
118 Seiten, 5,00 EUR.
ISBN-10: 3518457950
Rezi als PDF

|