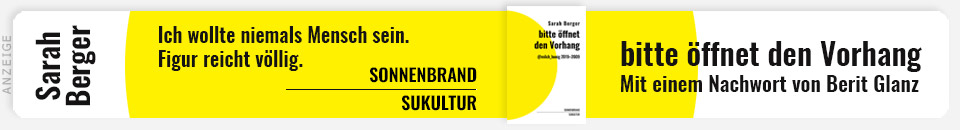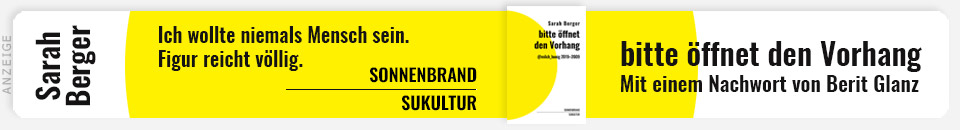Sorglos ins Bizarre
Christina Griebel, 1973 geboren, kann sich nicht beklagen: Mit ihren ersten Prosaversuchen bekam sie einen Platz in der Autorenwerkstatt des Literarischen Colloquiums, für ihre Erzählung "Und sie geigen Schostakowitsch" erhielt sie den Walter-Serner-Preis, und dieses Jahr wurde sie zum Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb eingeladen. Damit ist sie das, was man als "vielversprechend" bezeichnet. Erfreulicherweise kommt sie auch nicht aus dem Literaturschnellkochtopf des Deutschen Literaturinstituts, womit sie unter den Nachwuchsautorinnen schon fast eine Ausnahme zu sein scheint, sondern hat Malerei und Germanistik studiert. Also sehen wir uns mal ihr Erzähldebüt näher an, erschienen in der Taschenbuchreihe "Collection S. Fischer".
Zehn Texte versammelt der Band mit dem wenig marktkonformen Titel (wie feuilletontauglich flutschte dagegen Ricarda Junges "Silberfaden" über die Lippen!). Erzählungen möchte man sie nicht nennen, denn Griebels Stärke ist nicht das Erzählen, sondern das Beschreiben. Wieder einmal spricht das literarische Ich, und wieder einmal überkommt einen das Gefühl, dieses sei mit der Autorin identisch. Ihre Auslandsaufenthalte hat sie offensichtlich ebenso verwurstet wie den Aushilfsjob in einer Fabrik und eine Klassenfahrt nach Frankreich. Was ja nichts Schlechtes ist, wird doch stets von den jungen Autoren das Einbringen ihrer Lebenserfahrung verlangt. Ob diese Erfahrungen auch für Leser interessant sind, sei noch offen gelassen.
Wie ist das alles geschrieben? Bei ihren Betrachtungen alltäglicher Gegenstände verliert sich die Autorin in Details, und das genau ist der große Pluspunkt dieser Texte. Das Hinsehen auf Kleinigkeiten erzeugt eine ruhige, etwas gedankenverlorene Atmosphäre. Eigentlich alle Texte sind innere Monologe junger Frauen, und für die findet Griebel einen eigenen Ton. Der eigene Ton ist ja immer das Wichtigste, und gleichzeitig das, was man nicht erklären kann, sondern gelesen haben muss. Da wird die trostlose Behausung beschrieben, in der das Au Pair mit einem widerlichen Bauer hausen muss, bis hin zum versifften Waschbecken. Schattenwurf und Oberfläche eines Wellkartons werden bis in die kleinste Einzelheit herangezoomt, genauso wie ein entzündetes Ohrloch.
Das liest sich interessant und ist gut beobachtet. In den besten Momenten erzeugt dieses Beschreiben einen meditativen Zustand. Mit der Sprache hat die Autorin gar keine Probleme, die tauchen erst auf, wenn man sich ansieht, welche Inhalte diese Sprache transportiert.
Worum geht es? Ein Mädchen muss immer ihrem Freund hinterher rennen, das Au Pair will nichts wie weg von dem Einödhof, auf Klassenfahrt verliebt man sich in einen Franzosen. Pipifaxprobleme, mit denen man sich wirklich nicht mehr befassen möchte, wenn man über Zwanzig ist. Dieses klapperige Gerüst versucht Griebel, mit Bedeutung aufzuladen. Aber was hat es zu bedeuten, wenn der Bauer in den Stall scheißt oder der süße Franzose nichts von einem wissen will? Auffällig ist außerdem, dass überall Christliches hervorlugt, als traue die Autorin der Kraft ihrer Prosa nicht und versuche, sie zu überhöhen und ihr dadurch Bedeutung zu verleihen. (Da malt eine isländische Freundin den Liebhaber als Heiligen, ein Boot heißt Magdalena, ein Eisenengel passt auf eine Verrückte auf und Schwester Genoveva kommt zu Besuch. Auch Griebels Klagenfurt-Text befasste sich mit einer religiösen Spinnerin.)
Inhaltlich ist also nicht viel zu holen für den Leser. Und trotzdem ist Christina Griebel eine interessante Autorinnen, denn sie hat ihre ganz eigene Art zu schreiben, nicht auf den Kurs des neuen deutschen Erzählens getrimmt durch Creative-Writing-Seminare und Schriftstellerschulen. Man kann nur mutmaßen, ob die literarische Betreuung durch Literaturfachkräfte ihrer Prosa geschadet hat, wirken doch die Texte teilweise, als hätte sie versucht, es jemandem Recht zu machen (aber ich kann mich natürlich auch irren).
Richtig gut, ja wunderbar, werden Griebels Texte erst da, wo sie nichts mehr erzählen wollen und sorglos ins Bizarre abgleiten: In der Fabrik sitzen die Häßlichen und Ausgemusterten im Keller, die den Kriterien des Meister Leder nicht entsprechen: "Die echten Kellerleute, die mit den Hautunreinheiten, Kröpfen und Klumpfüßen, die säßen dort unten um ein Fass herum und jeder habe einen Löffel und damit kratzten sie Streichkäse aus runden Plastikbechern in eine große Tonne." Da entstehen beim Lesen kräftige, absurde Bilder.
Höhepunkt ist der letzte Text, "Zweihundert Meter in die Tiefe". Ein Paar lebt in einer Umgebung aus materialisierten Erinnerungen, die von einem unachtsamen Heizungsmonteur zerstört wird: "Mit dem Fahrtwind stürzte Leanders Preziosensockel um, ein Pappteller mit dem Gesicht nach unten auf vier hohen Drahtbeinen, der schon lange auf einen federleichten Gegenstand gewartet hat, den er tragen könnte." Jetzt könnte man sich drüber auslassen, ob ein vorbeigehender Mensch einen Fahrtwind erzeugt und ein Pappteller ein Gesicht hat, aber solche Ungereimtheiten machen Griebels Prosa auch lebendig.
Wie sie ein Netz aus Konnotationen über die belanglosen Gegenstände spannt, ein Bedeutungssystem, nur für die beiden Protagonisten erkennbar, bedeutungslos für jeden Außenstehenden, das ist so gut, dass man ihr allen Mädchenkram vergibt und sich denkt, es wäre schön, wenn sie hier weiterschreiben würde: Keine Geschichte erzählen wollen, dann ergibt sich die Geschichte ganz von selbst.