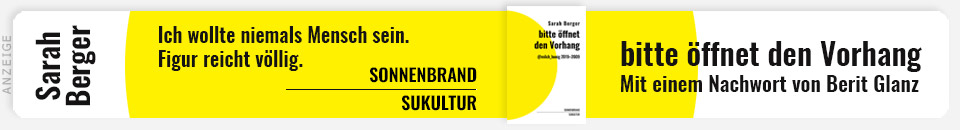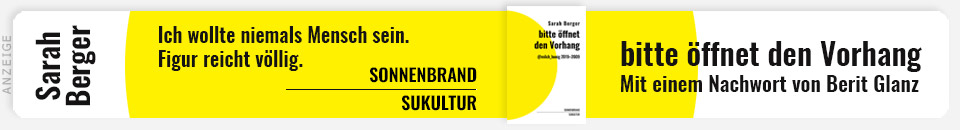Juan José Millás:
Die alphabetische Ordnung
An der Schwelle vom 17. zum 18. Jahrhundert stellt der irische Philosoph George Berkeley die Behauptung in den Raum, die Dinge hätten keine Existenz außerhalb ihrer Wahrnehmung durch den Menschen: Nur indem der Mensch sie sieht, schmeckt, riecht, hört, fühlt und ihnen einen Namen gibt, erhalten sie ihre Daseinsberechtigung.
Der derzeitige Kinohit
Matrix Reloaded verleiht einem ähnlichen Gedanken Aktualität. Wer ihn gesehen hat, mag angesichts der darin vorgeführten dekonstruktivistischen Entlarvung der Welt als Computerprogramm, als rein menschlich fabriziertes Konstrukt, vielleicht durchaus in Erwägung ziehen, daß unsere Wirklichkeit möglicherweise gar nicht so ist, wie sie uns erscheint, sondern uns nur vorgegaukelt wird, oder wir sie selbst mit allerhand Projektionen beladen.
Auf einer ähnlichen Idee gründet der Roman "Die alphabetische Ordnung" des Spaniers Juan José Millás (dessen deutsche Übersetzung fünf Jahre auf sich warten ließ): In der imaginären Welt des Ich-Erzählers und Protagonisten Julio existieren die Dinge nur, weil es die Worte gibt, mit denen sie bezeichnet werden.
In einer Folge von krankheitsbedingten Fieberträumen halluziniert der 14jährige eine alternative Welt herbei, die zunächst mit der realen identisch ist - bis er erlebt, wie sich eines Tages aus unerklärlichen Gründen alle Schriftstücke, vom Schulbuch bis zum Straßenschild, aus dem Staub machen und mit ihnen allmählich die Begriffe aus dem Wortschatz der Menschen verschwinden. Und mit dem Verlust der Begriffe kommen auch die Dinge selbst den Menschen mehr und mehr abhanden.
Anfangs noch belustigendes Ereignis, kulminiert der Rückzug der Wörter und Buchstaben schließlich im totalen Chaos: Die Menschen finden ihre Wohnungen nicht mehr, ihnen gehen wichtige Gebrauchsgegenstände und die Nahrung aus, weil die dazugehörigen Bezeichnungen fehlen, und sie verlieren ihre emotionalen Fähigkeiten, weil etwa das Wort "Kuß" und damit der Kuß selbst nicht mehr existiert oder aus Mangel an "L" die Liebe an Intensität einbüßt.
Von diesen Träumen heftig verunsichert, stellt Julio die konventionelle logische Ordnung der Welt in Frage und hält die alphabetische, wie sie das Lexikon vorgibt, dagegen: Warum soll auch das Abendessen nach dem Frühstück kommen? Und weil demnach die Dinge phänomenal genauso beschaffen sind wie ihre Bezeichnungen, minimieren Abkürzungen wie Mo, Di, Mi usw. für die Wochentage natürlich auch diese selbst – d.h. "man konnte gerade mal frühstücken, dann stand schon der nächste Tag bevor". Und daß Verben, läßt man sie sich mal bewußt auf der Zunge zergehen, "eine faserige Textur und einen intensiven Geschmack" haben, während Artikel und Präpositionen nach nichts schmecken und Konjunktionen Dörrobst ähneln ("Man konnte auf ihnen herumkauen, aber sie ersetzten keine Mahlzeit"), wissen neben Julio auch nur Synästhetiker.
Während Julio im ersten Teil des Buches der imaginären Welt, die immer unangenehmere Ausmaße annimmt, stets wieder entfliehen kann und ihr schließlich, wieder genesen und fieberfrei, ganz entsagt, fällt er im zweiten Teil als Erwachsener immer wieder in sie zurück, so sehr ist er von den aus den früheren Träumen gewonnenen Erkenntnissen beeindruckt und geprägt. Die Grenzlinie zwischen Realität und Imagination wird immer durchlässiger, so daß der vereinsamte Junggeselle plötzlich eine Frau und einen Sohn neben sich weiß, die durch ihre Verbalisierung, durch Sätze, in denen sie eine Rolle spielen, lebendig werden. Es sind also erneut die Worte, die die Geschehnisse in der Welt regulieren, allerdings nicht mehr im Modus der Zerstörung; sie entwickeln nun vielmehr eine positive Eigendynamik, sie produzieren Bedeutung, anstatt sie wegzunehmen, und erschaffen die Welt um Julio neu. Was in Matrix Realität ist, hält auch Julio für plausibel, nämlich daß nicht bloß die materielle Welt, sondern auch der Mensch lediglich ein – hier von Konversationslexika hervorgebrachtes – Konstrukt ist. Und weil das Leben nur durch einen möglichst großen Vorrat an Begriffen bereichert werden kann, schmerzt es ihn besonders, daß sein kranker Vater, der erst kurz vor seinem Tod beginnt, englisch zu lernen, ausgerechnet mit "I’m sorry" auf den Lippen stirbt – denn "auf englisch" zu sterben bedeutet für den Sprachanfänger, mit einer recht armseligen jenseitigen Welt zu tun zu haben, in der Entbehrung an der Tagesordnung ist.
Von theoretischer Seite betrachtet gibt das Buch sehr viele intelligente gedankliche Anreize; vielleicht ein wenig an Borges‘ labyrinthische Bibliothek von Babel erinnernd ist es ein Fest für Dekonstruktivisten wie für Strukturalisten, mit deren Programmatiken es spielt. Womöglich trifft man in neuerer Zeit, nach Texten von Cortázar, Borges und anderen postmodernen Autoren, kaum auf ein Buch, das so ausgeklügelte (Literatur)theorie in sich birgt und so originell mit den herkömmlichen Überzeugungen und Gesetzen der Logik spielt, wie dieses.
Leider geht das Ganze – bei allem Spaß, die der gewitzte und schlaue Inhalt erzeugt – auf Kosten der Literarizität: Alles ist sehr plakativ und zum Teil etwas zu breit ausgewälzt; nur seinem Inhalt und überhaupt dem klug erdachten Stoff verdankt das Buch seine Klasse. Sprachlich überwältigt es nicht unbedingt, es ist vielmehr von einer argen Schlichtheit, manchmal Spießigkeit, ja, Naivität des Ausdrucks durchzogen, was schade ist, weil sich der literarisch anspruchsvolle Leser deshalb hin und wieder auch ein bißchen langweilen mag. Weniger ist ja bekanntlich mehr – doch wenn schon die Phantasie des Lesers ein wenig auf der Strecke bleibt, so tut sie das immerhin zugunsten einer sehr phantasievollen Geschichte.