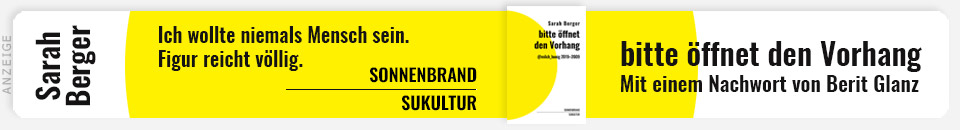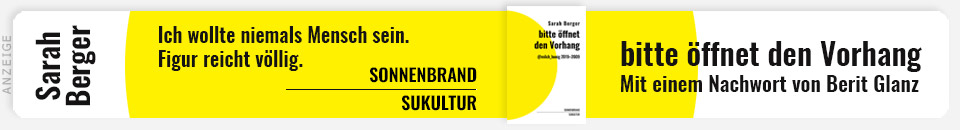Ronald Klein: Popmusik ist rhythmusorientiert. Power Electronics als Gegenentwurf nicht. Warum verzichtet Du persönlich auf Rhythmus?
Joris J: Rhythmus ist so alt wie die Menschheit selbst. Zu Trommelschlägen tanzten wir um ein Lagerfeuer und heute im Stroboskop-Gewitter. Rhythmus hilft beim Vergessen, Rhythmus präsentiert die körperliche Anwesenheit und die geistige Abwesenheit. Mir geht es jedoch nicht ums Vergessen, sondern um das Vertiefen. Ich schätze geistige Anwesenheit. In ihr liegt mehr Macht als in einem schwitzenden Körper.
RK: Whitehouse zum Beispiel kombinieren harmonische Choreographien mit ultrabrutalen und sexistischen Lyrics und dissonanten Sounds. Kritiker betrachten dies – trotz akademischen Backgrounds der Musiker – als Kindergartenspiel, während einige der Anhänger behaupten, hierin die Dekonstruktion von Herrschaftsverhältnissen zu sehen.
JJ: Whitehouse ironisieren in erster Linie das Überangebot an Sexualität und den Markt, der sich darum aufgebaut hat. Vergewaltigungsfantasien gekoppelt mit Aerobic-Choreographien: Vielleicht sind sie die Blaupause für alle Electro-Clash-Acts. Als Frau bist du halt nicht mehr "Baby", "Babe" oder einfach "Girl", sondern "bitch", "pussy" und "cunt". Die Reduzierung auf das organisch Notwendige ist ja eine Barberei an der Erotik. Du bist nicht sexuell befreit, sondern die "Rosinenstute" aus dem "Lidl". Anti-Hippie- und Pro-Beatnik-Allüren ergeben sich so automatisch. Andererseits stehen sie für mich eher in der Tradition von Schweinerockbands und der Track "A Cunt Like You" scheint eine zeitgemäße Umsetzung von "Heartbreak Hotel" zu sein.
RK: Bevor Du zum Noise kamst, hast Du in richtigen Bands gespielt, beherrschst Gitarre und Keyboards. Was bewegte Dich zum Musikwechsel?
JJ: Zuerst einmal ist man bei bandorientierter Musik von anderen Menschen abhängig und ich bevorzuge die Unabhängigkeit. Da erscheinen Leute nicht zu Proben, die Musiker sind unvorbereitet, die einzelnen Ziele der Musiker sind oft nicht übereinstimmend. Das Hauptanliegen vieler Bandmusiker scheint mir in erster Linie die Liebe zum alltäglichen Alkoholismus zu sein. Zweitens geht es mir ja um das Aufbrechen und Verwischen von Strukturen. Rockmusik ist jedoch unwiderruflich musikgewordene Struktur. Damit man das jetzt nicht falsch versteht, ich liebe gitarrenlastige Musik, aber als Hörer sollte man sich schon darüber im Klaren sein, dass man einen Stacheldrahtzaun, der als schwarze Flagge verkauft wird, schätzt. Ergo liebt man eine Lüge. Die Schwierigkeit bei Noise ist eine Wiederholung der Nicht-Wiederholung, Anpassung ist ein Sarg, doch bietet es mir als Musiker zur Zeit die größtmögliche Freiheit und natürlich liebe ich diese Musik. Um sie anzuerkennen, muss man sich entschließen, gegen den eigenen Sinn zu hören.
RK: Was heißt das konkret: „gegen den eigenen Sinn“?
JJ: Der Sinn des Hörers ist in unserer Zeit auf Wiederholung geeicht. Am besten wiederholt sich ein Fünf-Sekunden-Loop acht Minuten lang, gerade so ist man bereit einen Refrain von 30 Sekunden zu gestatten. Es muss leicht ins Ohr gehen und wenn man noch dazu tanzen kann, hat man solche Stücke schon ins Herz geschlossen. Dieses musikalische Korsett, welches sich mit einigen Ausnahmen durch die gesamte Popkultur zieht, hatte ihren Reiz und auch ihre Berechtigung. Es hat natürlich Charme, wenn jemand keine Meisterwerke, sondern "nur" Songs schafft, da man sich als Hörer nicht herabgesetzt fühlt, der Kreative erscheint als Freund, Liebhaber oder neuerdings auch als Vaterfigur. Natürlich gefallen mir auch Stücke aus diesem Bereich, aber wichtiger ist: Dieses Konzept ist einfach verbraucht. Es gibt nur noch die Wiederholung der Wiederholung. Deshalb muss der Sinn für Musik geändert werden und das heißt zuersteinmal, gegen den eigenen Sinn zu hören.
RK: Viele Power Electronic und Industrial-Acts spielen mit dem Image "politisch inkorrekt" zu sein. Throbbing Gristle sagten einst "We are not interested in music as such. We are interested in information" und erklärten damit ihr politisches Konzept, das gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse dekonstruiert. Mit SPK (Sozialistisches Patientenkollektiv) verhielt es sich ähnlich. Spielt gesellschaftliche Reflexion bei Deinen Kollegen noch eine Rolle?
JJ: Vielen spreche ich diese Reflexion ab. Da geht es mehr um das Erhalten oder Behalten eines Chics. Wenn ich etwas schickes sehen will, kaufe ich mir ein Modemagazin, wenn ich etwas schickes hören will, lege ich mir einen Deep House-Sampler zu. Bei Industrial erwarte ich aber etwas anderes: Konfrontation gepaart mit Reflexion, kurz audiovisuelle Courage.
RK: Langweilt Dich die x-te Wiederholung des vermeintlichen Tabubruchs im Industrial? Krieg, körperliche Gewalt, Sadomasochismus... Warum spielt die (Macht der) Wirtschaft überhaupt keine Rolle? Ist das Progressive des Industrials längst verbraucht und die Szene selbst das, was sie vorgab, nie sein zu wollen: stock-konservativ?
JJ: Für die meisten Acts trifft das sicherlich zu, aber heißt es nicht irgendwo: "90% von allem ist Schrott" ? Die Musik als solche halte ich auf keinen Fall für verbraucht, aber der Tabubruch, der ja immer der selbe ist, langweilt mich zu Tode. Außerdem hatte dieser Tabubruch nur Ende der 70er/ Anfang der 80er wirklich Sinn, man wollte eben die dauergrinsenden Hippies loswerden und vergraulen. Mit einem Hakenkreuz oder Symbolen, die aus diesem Umfeld stammen, hat das ja ganz gut geklappt. Wir leben im Jahre 2008. Die Hippies sind mittlerweile dienstwagengeil und haben die Bundeswehr in eine Angriffsarmee umfunktioniert. Warum spielt die Wirtschaft (nicht nur die Macht, sondern auch die abwesende Moral und Ethik) der Wirtschaft keine Rolle? Da kommen wir wieder zum Punkt der Reflexion. Um eine komplexe Thematik wie die Wirtschaft, ihrer Struktur(en) und ihre einsetzende Entgleisung in einem Tondokument zu behandeln, müsste man sich damit erst einmal beschäftigen und dann wären wir wieder beim Punkt der (fehlenden) Reflexion. Außerdem fehlt bei vielen die audiovisuelle Courage. Man hat wohl Angst, dass man seine Platten nicht an den Mann bringen kann.
RK: Dein Titel „Versorgungsbehörden Meldet Kriegsgewinnler“ vom aktuellen Album ist somit als Statement zu verstehen? Das klingt im philosophischen Sinn materialistisch, während das Okkulte, Irrationale ja gerade im Dark Ambient-Bereich sehr en vogue ist.
JJ: Ja, es ist als Statement zu verstehen. Letztendlich ist dieser Okkult-Boom nur der Nachhall auf den Mystery-Boom der 90er: „Treffen wir uns doch zu einem Akte X-DVD-Abend mit einer Schale voll Lichtkekse und dem Blut von Jungfrauen.“
RK: Glaubst Du, dass der Gothic-Boom, das Irrationale auch als Fluchtmoment verstanden werden kann? Bedeutet Gothic somit Rückzug, weil es bequemer ist, zu glauben, dass irgendwelche verborgenen Mächte das Schicksal steuern und nicht konkrete Menschen für das Unheil in der Welt verantwortlich sind?
JJ: Das Irrationale stellt sicherlich eine Flucht vor der realen Welt da. Das tauchte ja, um bei der Popkultur zu bleiben, verstärkt schon im Glamrock oder der Surfbewegung der 50er auf, obwohl es da lebensbejahend konnotiert war. Nun möchte ich eine solche Flucht nicht vollkommen verneinen. In ihr liegt ja die Hoffnung das man nicht nur selbst, sondern möglichst alle, um beim Irrationalen zu bleiben, diese Flucht teilen könnten. Somit würde die reale Welt zusammenbrechen und das Phantasie-Konstrukt würde Realität werden. Mittlerweile treibt es aber stupide Blüten. Genologie ist im Mainstream angekommen. Alle wollen plötzlich wissen, ob sie einen adligen Ursprung haben. Man hält Inkompetenz für Elitarismus und Wissensmangel heißt auf einmal Theosophie. Selbstredend ist es bequemer zu glauben, dass verborgene, möglichst nicht greifbare Mächte das Schicksal steuern, somit weist man jede Verantwortung von sich und das Gefühl der Unschuld bleibt erhalten. Zwei Probleme der Jetzt-Zeit werden dadurch deutlich: Erstens: die Unfähigkeit zur Konsequenz. Zweitens: Jeder hält sich für einen verkannten Hiob.
RK: Bei Deinem aktuellen Album zeichnest Du auch für das Cover verantwortlich. Fühlst Du Dich musikalisch nicht genug ausgelastet?
JJ: Ich habe für alle Veröffentlichungen die Covers entworfen. Ich möchte über mein Werk so viel Kontrolle wie möglich behalten. Ich schließe aber nicht aus, in Zukunft einen
Außenstehenden heranzuziehen. Ich weiß es noch nicht.
RK: Was bedeuten die mysteriösen Songtitel auf der aktuellen CD?
JJ: So mysteriös sind sie gar nicht. Sie bezeichnen die Stadien des Informationsflusses in einem sich in immer mehr Nebel hüllendes Konzept, genannt „Transaktion“: Geldtransfers von der ersten in die dritte Welt. Gibt es keinen Krieg, gibt es kein Geld. Gibt es kein Geld, gibt es kein Brot für die Welt. Ein perfider Automatismus, der uns beweist, dass wir als Menschen maschinell kontrolliert werden. Das Verhältnis sollte aber umgekehrt sein.
RK: Mit wem würdest Du musikalisch kooperieren? Taktlo$$ z.B.?
JJ: Taktlo$$ ? Das wäre wirklich nicht uninteressant. Er gewinnt einem Genre, das sich bedauerlicherweise der Erfassung von Kleingeistigkeiten widmet, etwas ab, was ich sympathisch finde, er ist teilweise audiosynkratisch. Zur Zeit steht eine Kooperation mit einem Musiker an, der interessanten überbordernd rhythmusbetonten Kram macht. Mehr möchte ich aber noch nicht verraten. Allgemein halte ich musikalische Kooperationen zwischen audiovisuellen Gegensätzen für erstrebenswert. Eine Chanson-Sängerin wäre reizvoll, ein Maultrommler ebenso. Wenn die musikalische Auslegung ähnlich sein sollte, ist ein Austausch von Rohmaterial und anschließende Bearbeitung interessant. Wie weit kann ich einem Sample meine Individualität aufdrücken oder wie weit bin ich bereit, meine Individualität für die Bearbeitung eines Samples zurückzustellen? Daraus kann großes entstehen!
RK: Kannst Du etwas zur Bedeutung Deines ominösen Spitznamens „das schmatzende Sexbein“ verraten?
JJ: Das schmatzende Sexbein ist quasi mein Verbal-Alter Ego beim Radio. Ich schmatze beim Reden und zeige den Leuten in den Aufnahmestudios meine Beine, ob sie das nun wollen oder nicht.