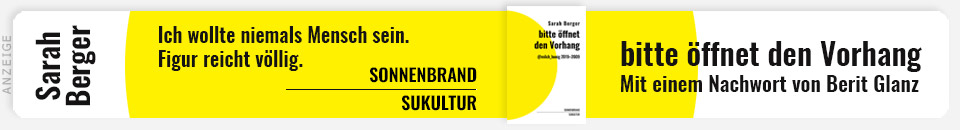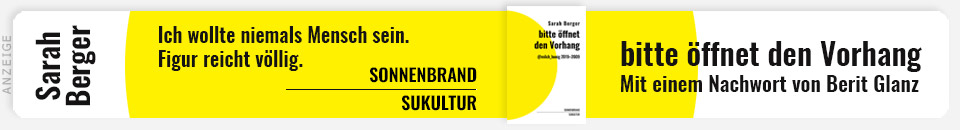| |
 Ben Ratlif: Coltrane
Siegeszug eines Sounds
Hannibal Verlag 2008
262 S., 24,90 €
» Hannibal
» amazon
|
Coltrane ohne Mythos
Akribisch und subjektiv schreibt Ben Ratliff, was es heißt, unter dem Joch des Saxofontitanen zu leben und erinnert an die Zeit, als Kritiker noch mit dem Tode bedroht wurden.
Man kann über John Coltrane, den mythisch Verehrten, der vielleicht eher Hippie als Freejazzer war, eine Heldengeschichte schreiben. Das geht sogar ganz einfach. Die Story könnte anfangen mit einer relativ unspektakulären Kindheit in einem musikalisch-religiösen Elternhaus, der Zeit bei der Navy, bei der der jugendliche Held eine frühe Platte aufnimmt. Was eigentlich illegal geschieht, denn die Band, in der er das tut, besteht aus Weißen. Als Schwarzer hat er da im Jahre 1946 eigentlich keinen Zutritt. Der Protagonist würde dann in durchaus kommerziellen Kapellen sein Brot verdienen und irgendwann beginnen, viel zu trinken und sehr viel Drogen zu konsumieren. So viel, dass es selbst Miles Davis, bei dem Coltranes Stern zu glühen beginnt, gegen den Strich geht und er seinen Schützling erst mal vor die Tür setzt. Danach der Entzug auf Männerart, kalt nämlich. Es käme das Kapitel Thelonious Monk und der Held darf mehr und mehr verwegen werden. Er würde eine Sinnsuche beginnen und ein zweites Mal heiraten. Während seine Mitstreiter weiter Raubbau an ihrer Gesundheit treiben, schließlich haben wir es mit Jazzmusikern zu tun, die dürfen das nicht, die müssen, würde er Religionen studieren. Man könnte andeuten, dass Coltrane irgendwann vielleicht doch noch mal LSD genommen hat und breit schildern, wie er in seiner Musik dahin gegangen ist, wo es sehr einsam wird. Am Ende stünde mit vierzig Jahren der skandalös frühe Tod an Leberkrebs. Man kann das so schreiben, und eine dieser Heldengeschichten steht hier. Es gibt nur ein Problem: Coltranes Story ist nur bedingt bestsellertauglich. Es gibt kein genialisch-zerschossenes Frühwerk, das man mit seiner Zeit als Junkie korrespondieren lassen könnte. Der schwindelerregende Gipfelsturm begann spät, als Coltranes Leben in sehr geordneten Bahnen verlief. In Interviews war er alles andere als ein Titan. Und seine Musik, die mochte er schon gar nicht erklären.
Ben Ratliff, seit 1966 Jazzkritiker der New York Times, einer, der in Platten lesen kann wie in einem Buch, hat sich dem Problem gestellt und die Geschichte John Coltranes ohne Mythos geschrieben. Ratliff versteht sich als Kritiker, nicht als Biograph und hebt hervor: »Da wir noch immer unter seinem [Coltranes] Joch stehen, uns jedoch im Prozess befinden, es abzustreifen, scheint der Zeitraum günstig für einen Versuch, sein Lebenswerk zu analysieren.« Ratliffs Buch setzt, das muss gesagt werden, beim Leser einiges voraus. Mindestens erst mal eine sehr gründliche Kenntnis des Coltraneschen Œuvres und im Idealfall musikalische Grundkenntnisse. Ratliff möchte Coltrane, so weit das geht, ohne Rückgriff auf nichtmusikalische Metaphern interpretieren. Kurz gesagt: Wer wie der Rezensent keine Ahnung von Noten hat, wird speziell in der ersten Hälfte des Buches, in der Ratliff Coltranes Werkbiographie und die Genese seines Sounds schildert, gelegentliche Schwierigkeiten haben. Dabei leistet sich Ratliff mehrmals, was sich eigentlich auch kaum ein Kritiker mehr traut. Er wird in seinem Urteil gerne subjektiv und kratzt an Denkmälern. »Om« (1965), ein gefährlich-irres Stück Musik aus Coltranes Spätphase, der Rezensent hörte es 1992 unter dem Einfluss holländisch präparierter Zigaretten und ward ein Anderer, hält Ratliff für »eine ziemlich unzusammenhängende, agitierte, schlammige, neunundzwanzigminütige Katharsis, die aus einer sechsstündigen Session zusammengeschnitten wurde.« Ob ich mir das damals wirklich sechs Stunden hätte anhören können, sei dahingestellt. Fest steht aber: Unter Katharsis machten wir es 1992 nicht. Große Stücke hält Ratliff dagegen auf »Crescent« (1964), in der Tat einem großartigen Album, das dann ein Jahr später in meinem Berliner Zimmer am Kollwitzplatz lief. Ratliff weist, und das ist vielleicht wirklich Teil der überwältigenden Wirkung dieser Platte, darauf hin, dass die Melodien von dreien der Stücke vom Sprechrhythmus eines Textes, eventuell Coltranes nie gefundenen Gedichten, abgeleitet seien und er sich auf »Crescent« Musik als Sprache im eigentlichen Sinne näherte. Hundertprozentig puritanisch verfolgt Ratliff sein Vorhaben dann doch nicht. Einmal, Coltranes Arbeitsweise als work in progress beschreibend, verweist er auf Björk und Thomas Bernhard (!), ein andermal schreibt er über »Live At The Village Vanguard« (1961): »Es schien, als könne man diese Welt betreten und womöglich nicht wieder hinausfinden.« Der mit dem Dizzy Gillespie Sextett eingespielte »Congo Blues« (1951) erinnert an »einen Seufzer rückwärts«. Und im Rückgriff auf den Dichter und Zeitgenossen Robert Lowell schreibt Ratliff von der »Monotonie des Erhabenen«, die die Musik Coltranes ausgezeichnet habe.
Im zweiten Teil untersucht Ratliff Coltranes Hinterlassenschaft bei anderen, bei Musikern, Kritikern und Journalisten. Amiri Baraka (=LeRoi Jones), einstmals schwarzer Kulturnationalist, dann Marxist, 1990 Mitverfasser der Autobiographie Quincy Jones' und 1998 Schauspieler in Warren Beattys »Bulworth«, kommt zu Wort. Ratliff greift noch einmal Lowells Bild von der »Monotonie des Erhabenen« auf und koppelt es dann mit einer wesentlich radikaleren Aussage. Coltrane habe Mitspielern wie Hörern einen fast rituellen Bezug zur Musik ermöglicht und den Zugang zu »Elementen unter der Oberfläche des amerikanischen Selbstverständnisses« eröffnet. Ratliff nennt diese Elemente indianisch und afrikanisch, aber das lässt sich erweitern. Es ist exakt die Oberfläche dieses Kulturverständnisses, die unser gerne gepflegtes Bild vom verwässerten, ja dummen Amerikaner prägt. Ein Blick in die Platten- und Bücherregale durchschnittlicher satt.org-Leser sollte genügen, um zu überzeugen, dass dieses Bild barer Unfug ist, dass da immer schon mehr war. Es kann auch kein Zufall sein, dass der bessere Teil der sechziger Jahre Coltranes wohl bekannteste Platte, »A Love Supreme« (1964), als Ikone unterm Arm trug, das aufklappbare Cover gar als Peace-Zeichen des Jazz an die Wand hängte, wie sich Konrad Heidkamp 20 Jahre später erinnern sollte. Es muss eine aufregende Zeit gewesen sein, als über Musik noch weltanschauliche Fehden ausgetragen wurden. Ratliff schreibt, wie Don Ellis, ein Trompeter, der das Pech hatte, weiß und blond zu sein, 1965 einen Coltrane-Artikel für die Zeitschrift »Jazz« schrieb und sich etwas Kritik erlaubte. Ellis meinte, Coltrane würde nie ganz in der Musik aufgehen, sondern eher über sie hinweg spielen. Seinem ganzen Quartett mangele es an Gespür für Kontraste. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Charles Moore, Trompeter auch er, befreundet mit John Sinclair, dem Manager der legendären MC5 und zuvor Propagandist der White Panther, holte zum Rundumschlag aus und drohte: »Seine Kritik zu The John Coltrane Quartet Plays zeigt, wie sehr den Weißen schwarze Kreativität zuwider ist; die Taktik der Weißen, schwarze Musik von oben herab als 'Verzierung und Dekoration' abzutun. [...] Ich möchte noch nicht einmal den Versuch unternehmen, Ellis die Musik der Schwarzen zu erklären, weil er ganz offensichtlich nicht einmal die fundamentalen Gefühle erfassen kann, aus denen heraus diese Musik geschaffen wurde. Offensichtlich können die Weißen nicht einmal auf der untersten Stufe sexueller und masochistischer Fantasien verstehen, was Schmerz & Leiden bedeuten. [...] Das Gefühl dieser Musik ist mir wichtiger als ihre technischen Aspekte; ein Gefühl, das Sie, Herr Ellis, in den Schmutz gezogen haben, wodurch Sie sich zu einem weiteren meiner vielen weißen Feinde erklärt haben. Und dafür müssen Sie sterben, zusammen mit ihren Idealen und Artefakten aus längst vergangenen Tagen.« Der Jazz kann fürchterlich gefährlich sein. Seid gewarnt, seid fasziniert. Oder besser, seid beides.
» www.johncoltrane.com