Interaktive Infografiken sind so alt wie die Bemühungen der Print-Medien im Netz Fuß zu fassen. Seit einem Jahr verkauft man sie der breiten Öffentlichkeit unter einem neuen Namen: (visueller) Datenjournalismus. Alter Wein in neuen Schläuchen? Oder steckt mehr dahinter? Bei der Medien-Konferenz re:publica gab es reichlich Anschauungsmaterial dazu. Berliner Gazette-Herausgeber Krystian Woznicki hat es sich angeschaut.
*
Vor zehn Jahren erlebten einige partizipative Formen der Berichterstattung ihren massenmedialen Durchbruch. Nach dem 11. September 2001 speiste sich der offizielle Nachrichtenstrom zu einem erheblichen Anteil aus Bildern von Amateur-Videos. Im darauf folgenden Afghanistan- und Irak-Krieg konnten Online-NutzerInnen bei der Schlachtordnung und den neu entstehenden geopolitischen Konstellationen mitmischen – zumindest vermittelten interaktiv-blinkende Infografiken diesen Eindruck. Der Blick vom “Feldherren-Hügel” war augenscheinlich kein Privileg mehr, sondern Gemeingut.
Im Jahr 2010 präsentierte der Guardian interaktive Infografiken zu den beiden Kriegen und löste einen Sturm der Begeisterung aus. Die digitalen Karten wurden als bahnbrechendes Novum gefeiert und man durfte sich fragen: Hatten alle schon vergessen, dass es solche Vermittlungsangebote zu Beginn der Kriege auch schon gegeben hatte? Oder wurden die Infografiken des Guardian deshalb so sehr gefeiert, weil sie sich aus einer schier endlos großen Menge von ehemals geheimen Daten speisten, die durch WikiLeaks an die Öffentllichkeit gelangt waren?
Kurz, was verschaffte den Inforgrafiken des Guardian diese enorme Aufmerksamkeit und verhalf im Zuge dessen der Schule des visuellen Datenjournalismus zum Durchbruch: War es Amnesie? War es die Begeisterung über die Bewältigung von ungeheuren Datenbergen? Oder waren es die langen Schatten des Hypes um WikiLeaks?
Die Vorreiterrolle des Guardian
Viele Dinge haben sich in den letzten zehn Jahren verändert, so auch das Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit für Daten. Ob nun der alltägliche Blick auf die teils überwältigenden Datenströme der sozialen Netzwerke wie Twitter und Facebook, den Nicolas Kayser-Bril zum Ausgangspunkt für seinen Vortrag auf der re:publica machte oder die philosophische Annahme, unser Leben setzte sich aus Daten zusammen, die Chris Taggarts Vortrag zu Grunde lag – es gibt eine gesteigerte Aufmerksamkeit gegenüber Daten, die sich ebenso in Datenschutz-Kampagnen äußert wie im Subtext der massenmedialen Schlagzeilen zu WikiLeaks und Julian Assange. Eine Aufmerksamkeit, die ex negativo vermuten lässt, dass die lange Ära der digitalen Unschuld ad acta gelegt werden kann.
Die lange Ära der digitalen Unschuld ad acta legen – so könnte wohl auch die Motivation des (visuellen) Datenjournalismus formuliert werden. Immerhin gilt es bei dieser journalistischen Praxis die immer komplexer werdenden Datenströme und -bestände zugänglich und vermittelbar zu machen. Das wäre übrigens auch der maßgebliche Unterschied zu der herkömmlichen Arbeit von Online-Infografikern: Die Datenbanken, aus denen sich eine Karte der militärischen Operationen im Irak speist, werden 1) offengelegt und 2) in analytisch strukturierten Grafiken visuell vermittelt. Es ist diese neue Daten- und Prozess-Transparenz, die der Guardian mit seiner Arbeit im vergangenen Jahr zu einem neuen Standard der interaktiven Infografik gemacht hat. Und die zurecht auf den neuen Namen Datenjournalismus hört.
Was dahinter steckt, ist deutlich mehr als der Versuch der großen Verlagshäuser blinkende Infotainment-Angebote für ein schnell gelangweiltes Online-Publikum zu schaffen. Es geht um die für eine Demokratie im Zeitalter der Digitalisierung grundlegende gesellschaftspolitische Idee von offenen Daten (Open Data), auf die Journalisten und BürgerInnen frei zugreifen können. Um diesen Kontext zu betonen wurden die gestrigen Vorträge zum Datenjournalismus auf der re:publica von Programmpunkten zu Open Data und Open Government gerahmt.
Datenjournalismus: Die Baustellen
Trotz der engagierten Agenda kann sich der visuelle Datenjournalismus in der gegenwärtigen Verfassung nicht vollends von den Vorbehalten gegenüber der ersten Ära von interaktiven Infografiken lösen. Wie auch in dem Vortrag von Gregor Aisch klar wurde, der über seine Arbeit für unter anderem Zeit Online berichtete, gibt es noch keine hinreichenden Lösungen für das Problem der Simplifizierung. Visuelle Vermittlungen von komplexen Zusammenhängen neigen heute wie gestern dazu 1) unpräzise zu sein, 2) Fakten zu unterschlagen, 3) einseitige Meinungen zu beflügeln und schlimmstenfalls Populismus zu befördern.
Die Legenden von datenjournalistischen Karten legen in vielen Fällen keinen Wert darauf, die blinden Flecken der eigenen Arbeit offen zu legen. Sie begnügen sich damit, die Leistung zu erklären, nicht aber transparent zu machen, was das jeweilige Angebot nicht leisten kann, beziehungsweise vielleicht sogar verschleiert. Speziell in Deutschland besteht zudem häufig das Problem, dass die Angebote des visuellen Datenjournalismus (etwa von Spiegel Online oder Zeit Online) komplexe Datenbestände lediglich visuell vermitteln, jedoch nicht zugänglich machen. Die Konsequenz: Die Öffentlichkeit hat nicht die Möglichkeit, die Quellen zu überprüfen.
Das neue, aufgeklärte Bewusstsein für Daten – es gehört nicht nur den Regierungen, sondern auch den mündigen BürgerInnen der digitalen Gesellschaft. Doch haben sie es bereits? Der (visuelle) Datenjournalismus spielt in dieser Hinsicht eine zentrale Rolle. Doch der Blick auf dieses dynamische Feld lässt im Augenblick keine eindeutige Antwort zu. Das liegt nicht zuletzt daran, dass der Datenjournalismus selbst noch in den Kinderschuhen steckt.
Anm.d.Red.: Alle Bilder in diesem Artikel sind Screenshots diverser Infografik-Angebote des Time-Magazine aus der (Vorbereitungs-)Zeit des dritten Golfkriegs.



 MORE WORLD
MORE WORLD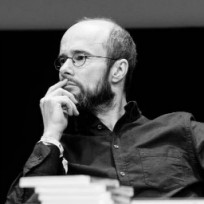

20 Kommentare zu
Ich finde ja, dass alle Daten die mit öffentlichen Geldern entstehen, auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen sollten, wie genau dann die Aufarbeitung passiert ist natürlich schwierig, weil natürlich auch hier eine selektive Auswertung passiert und man sehr leicht in den Populismus verfallen kann.
Was genau der Guardian mit den Infografiken bezwecken wollte kann ich weiterhin nicht einordnen: interessiert es mich wirklich wann an welcher Stelle wer erschossen wurde? Wenn ja: warum? Ich stehe Infografiken oder interaktiven Tabellen sehr skeptisch gegenüber, weil sie manchmal nur einen Voyeurismus bedienen und nicht aufklären.
Dazu hatte ich in meinem jugendlichen Leichtsinn schon mal 2007 einen kurzen Text geschrieben:
http://www.ohrenflimmern.de/2007/04/csi-spon/
Bei Twitter habe ich aber gerade gelesen, dass Domscheidt-Berg gesagt haben soll, dass aus Angst vor Transparenz jetzt weniger aufgeschrieben wird.
http://twitter.com/#!/gutjahr/status/58512273202880512
Vor kurzem habe ich ein Interview mit Gerd Bosbach gesehen. der ehemalige Mitarbeiter des Statistischen Bundesamt hat ein Buch herausgegeben "Lügen mit Zahlen" in dem er viele Beispiele aufzählt wie man besonders visuell Daten manipulieren kann.
Der Glaube daran, dass alle Daten immer ausgewertet werden und Datenjournalismus nicht voreingenommen ist, macht die Sache noch gefährlicher, weil man nie vergessen sollte, dass Programmierung nicht wertfrei ist und es für mich zum Beispiel sehr schwer ist dies zu überprüfen.
Hier noch der Link zu dem Buch:
http://www.amazon.de/L%C3%BCgen-mit-Zahlen-Statistiken-manipuliert/dp/3453173910
Wie viel Bürgerjournalismus ist bei dieser (neuen) Journalismusform möglich? Das Ganze riecht ja sehr danach, dass man spezielle Programmierkenntnisse mitbringen muss.
Gab es zu diesem Thema Aussagen der ExpertInnen auf der re:publica?
"Information graphics are visual representations of information, data or knowledge often used to support information, strengthen it and present it within a sensitive context. They are specific, context-sensitive and often times hand-crafted.
Data visualizations are visual displays of measured quantities by means of the combined use of a coordination system, points, lines, shapes, digits, letters quantified by visual attributes.
They are general, context-free and often times created automatically."
Gefunden hier: http://www.quora.com/What-is-the-difference-between-a-data-visualization-and-an-infographic
Ganz recht, das scheint mir momentan auch noch der Nachteil dieser Grafiken zu sein - und v.a., dass manche Menschen sich allein durch das herumklicken auf diesen ausreichend informiert fühlen. Womit wir aber wieder bei dem Einzelnen und seiner Verantwortung wären sich tiefer greifend zu informieren. Denn man sollte nicht der Illusion verfallen, alles perfekt aufgearbeite aus einer Hand (am Besten noch einer Grafik!!) erhalten zu können.
Das konnte man doch auch bei der Japan-Katastrophe beobachten: da stellt sich einer vor die Tafel, zeigt Zahlen, Rechenschritte, Formeln, und ein paar Kurvenverläufe, zack, auch wenn man die nicht wirklich versteht, so wirken sie... und die Aussagen werden wahrhaftig durch sie...
http://www.taz.de/1/netz/netzkultur/artikel/1/programmierer-als-journalisten/
ich habe bei heise online einen text gefunden, der die sich voralem beschäftigt mit der frage, ob und wie daten zu öffnen sind für die gesellschaft:
"Agrarsubventionen und Feinstaubwerte, Listen mit Ekelrestaurants oder öffentliche Bauaufträge: Diese Informationen können helfen, der Politik auf die Finger zu schauen, oder Entscheidungen beeinflussen, wo man lieber nicht ist oder hinzieht."
http://www.heise.de/newsticker/meldung/re-publica-Freiheit-fuer-oeffentliche-Daten-nur-auf-Raten-1227902.html
Julian Assange on cable reporting and cable journalism
http://www.thehindu.com/opinion/interview/article1701577.ece
http://blog.zeit.de/open-data/2011/04/15/diskussion-uber-open-government-in-deutschland/
( http://prezi.com/e7tfgnu2zpua/republica-xi-110413/ )
ich komme auf die anderen Punkte im Laufe des tages zu sprechen.
Seit vergangenem Jahr wird an dem Handbuch “Universalcode – Journalismus im digitalen Zeitalter” gearbeitet. Ulrike Langer und Christian Jakubetz hatten 2010 das Vorhaben angeschoben. Anlass war, dass es im deutschsprachigen Raum kein entsprechendes Werk rund um zeitgemäßen Onlinejournalismus gibt. Mittlerweile liegen rund 750 Bestellung des Buches vor und es geht bald in den Druck (24,90 EUR – Kauf per Klick auf den Warenkorb oben rechts im Widget); neben der Printversion wird es auch günstigere elektronische Ausgaben geben. Reich wird damit niemand; Herausgeber wie Autoren arbeiten ehrenamtlich. Aktuelles zum Buch ist bei Christian Jakubetz zu erfahren.
Zusammen mit Ulrike Langer von medialdigital habe ich das Kapitel über Datenjournalismus verfasst. Es lässt sich im folgenden Widget komplett lesen (ab Seite 10) oder hier in etwas größer und auf Doppelseiten. Ab Seite 37 findet sich der lesenswerte Beitrag von Marcus Bösch über “Mobile Reporting”.
http://www.book2look.com/vBook.aspx?id=cgsLIlErZ5&euid=5518385&ruid=4174849