Was haben Subcomandante Marcos und Geert Lovink über die Zukunft des Lesens zu sagen. Krystian Woznicki hat sich im Web 2.0 nach Antworten umgeschaut.
Laien, die das Wort ergreifen und sich in Diskussionen einmischen, die sonst nur ExpertInnen zugaenglich sind. Die sich Gehoer verschaffen, selbst wenn sie nicht Rhetorik studiert, keine PR-BeraterInnen und auch keine Aktienanteile in der Medienindustrie haben, welche eine gewisse Lautstaerke garantieren. Die die Gehirnwaesche, die Betruegerei und die Ausbeutung anprangern, und die die ganze Abzocke des spaetkapitalistischen Staates und der gleichfalls spaetkapitalistischen Wirtschaft nicht mehr einfach so hinnehmen und schreiben, schreiben, schreiben, immer dann, wenn es besonders weh tut. Web 2.0 stellt eben diesen Laien-Journalisten Technologien zur Verfuegung, die die Selbstermaechtigung selbstverstaendlich machen: Push the Button-Publishing.
Stimmen werden auf diese Weise hoerbar, die vorher nicht hoerbar waren. Wie ich in meinem Podiumsbeitrag letzten Freitag zu zeigen versucht habe, laesst sich an dieser Stelle eine Verbindung herstellen zu der Selbstermaechtigungspraxis der Widerstandsbewegung in Chiapas. Deren Anfuehrer Subcomandante Marcos nimmt hierbei die Funktion von – sagen wir – der Blog-Software ein: Durch seinen immensen literarischen Output macht er ungehoerte Stimmen hoerbar: von Insekten, Indigenas sowie Globalisierungsgegnern aus dem Alltag der Widerstandsbewegung und nicht zuletzt von durch die Geschichtsschreibung unterdrueckten und vergessen gemachten Figuren.
Doch waehrend Web 2.0 ein (zusammenhang)loses Netz von Stimmen ist, bekommen sie durch das Werk des Subcomandante Marcos einen Platz in den grossen Erzaehlungen der globalisierungskritischen Bewegung zugewiesen. Hierin sehe ich wiederum eine Verbindung zu der Arbeit der Berliner Gazette. Das allgegenwaertige Stichwort Buergerjournalismus im Netz ist fuer uns quasi >Schnee von gestern<: Vor nunmehr fast acht Jahren haben wir angefangen auf diesem Gebiet zu experimentieren. Mittlerweile haben wir diesem Vorhaben spezifische Konturen verliehen. Protokoll heisst ein von der Berliner Gazette entwickeltes Format, welches durch Fragen der Redaktion ungehoerte Stimmen hoerbar werden laesst (uebrigens nicht nur von Laien-Journalisten) und zwar innerhalb redaktionell konzipierter Themenschwerpunkte, die ihnen wiederum diskursive Bedeutung zuteil werden lassen.
Trotz Filter-Funktion stellen die BG-Protokolle den Leser immer wieder vor Raetsel: Warum lesen wir das eigentlich? Warum muessen wir all diese ganzen Details in Erfahrung bringen?
, fragte letzten Freitag der niederlaendische Medientheoretiker Geert Lovink aus dem Publikum heraus. Es war eine rhetorische Frage, denn die Antwort lieferte er gleich darauf selbst: Es ist eine Literatur, die ihren Leser noch finden muss, vielleicht erst im naechsten Jahrhundert.
Ganz so lange wollen wir natuerlich nicht warten. Jetzt schon ist klar: Wer heute die herkoemmlichen Massenmedien in Frage stellt, muss auch ihre (narrativen) Formate in Frage stellen und muss sich offen zeigen gegenueber neuen Ausdrucksformen. Auch was unter spannender Lektuere
zu verstehen ist, muss folglich neu geklaert werden.



 MORE WORLD
MORE WORLD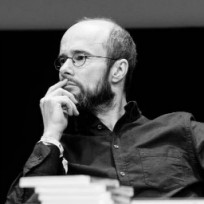

3 Kommentare zu
http://ssl.einsnull.com/paymate/search.php?vid=5&aid=1637
etwas geschrieben, dass in diesem Zusammenhang bestens passt:
Worin bestehen aber die Unterschiede zwischen diesem literarischen Format und dessen elektronischer Variante, die die Berliner Gazette im Bereich des Online-Journalismus zu prägen versucht?
Die Lebenswelt des Interviewten wird durch das elektronische Protokoll merklich fragmentarischer ausgeleuchtet als etwa durch die Ergebnisse einer Erika Runge. Richtig, es steht grundsätzlich weniger Platz zur Verfügung. Entscheidender ist jedoch, dass die elektronischen Interviews bestenfalls mit Hilfe von montageartigen Eingriffen geformt, nicht jedoch, wie bei der protokollarischen Transkription eines Gesprächs, narrativ ausgerichtet werden können. Darüber hinaus schließt das klassische Protokoll den Interviewpartner weitestgehend von der Verschriftlichung aus im Kontrast zu der elektronischen Variante, die ausschließlich auf der Schriftebene operiert, dabei jedoch weniger den Regeln des gemeinsamen Schreibens folgt, als vielmehr des klassischen Frage- und Antwortspiels. Das Ergebnis wirkt tendenziell unvollständig sowie offen und zeichnet sich in manchen Fällen durch eine Art mündlichen Sprechens aus. Dies sind alles in allem Eigenschaften, die den digital-interaktiven Produktionsbedingungen geschuldet sind und die die elektronische Ästhetik der BG-Protokolle ausmachen.